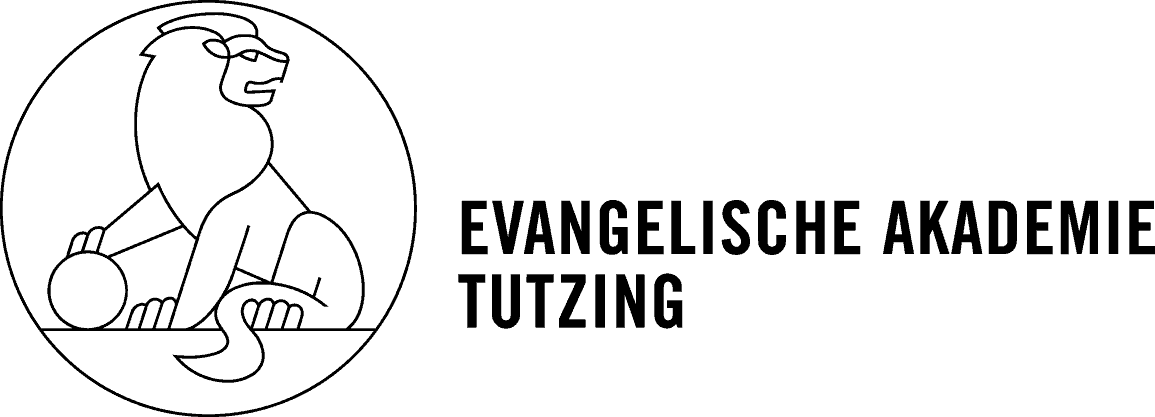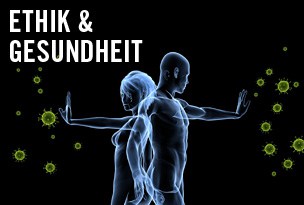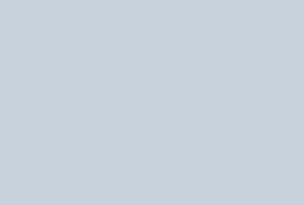Newsletter April 2022

Ich merke, ich brauche Bilder, um all diese Informationen zu verarbeiten und um Erinnerungen zu stützen. Bilder strukturieren nicht nur meine Gedanken, Bilder formen auch allgemein Vorstellungen, Geschichten, Erinnerungen, Identifikationen. Wie sehr, wurde auf unserer Tagung „Sehen und gesehen werden – Teilhabe im Film“, einer Kooperation mit dem Filmfest München, mehr als deutlich (zum Videobericht).
Dabei zeigten wir unter anderem Filme, von denen es noch zu wenige gibt in der deutschen Filmlandschaft: „Ivie wie Ivie“ von Sarah Blaßkiewitz, den kammerspielartigen Film „I am“ von Jerry Hofmann und der britische Kurzfilm „The Black Cop“, der die wahre Geschichte eines schwarzen Ex-Polizisten erzählte. In allen drei Werken wurde der Cast divers besetzt, es ging um Identität, Trauer, Ausgrenzung, Rassismus.
Denn: Betrachten wir die Mehrheit der öffentlich sichtbaren Filmbilder, könnte man auf den Gedanken kommen, unsere Welt besteht zum größten Teil aus weißen Männern, heterosexuell und im richtigen Körper geboren, gerne aus der Mittelschicht oder darüber und ein paar schlanken weißen Frauen, höchstens 35 Jahre alt, ohne Behinderung und ohne äußerliche Merkmale einer migrantisch geprägten Biografie oder Herkunft.
Die Realität sieht anders aus. 26 Prozent der Bevölkerung in Deutschland haben eine Migrationsgeschichte, im Kino ist das aber nur bei 15 Prozent aller Protagonist:innen der Fall. Nur eine Zahl von vielen aus einer von der MaLisa Stiftung initiierten Studie zur Diversität des deutschen Kinos (Livestream der Präsentation aus unserer Tagung hier abrufen).
Das Problem ist zudem: In den ewig gleichen weißen, heteronormativen Geschichten und Gesichtern erkennen sich viele Menschen nicht wieder, sie fühlen sich ausgegrenzt und abgelehnt. Filmschaffende mit Migrationshintergrund bekommen weniger Rollenangebote und wenn, sind sie oft klischeebehaftet. Finanzierungen und öffentliche Fördergelder fließen in Filmprojekte mit Geschichten aus der immer gleichen Welt, weil diversere Geschichten als „zu speziell“ gesehen werden, als Problem. Das erzeugt Wut und Frustration. Und das hilft uns allen kein Stück weiter in einer Welt, die bunt, vielfältig und komplex ist.
„Ich sehe mich als Chance“, sagte die Schauspielerin Sheri Hagen und ich nehme das als Appell. Chancen sehen, wo manche Probleme vermuten, sich auf Neues einlassen, um zu verstehen, das wünsche ich uns – in Bildern, Sprache und Auseinandersetzung.
Ihre
Dorothea Grass
Studienleiterin / Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit