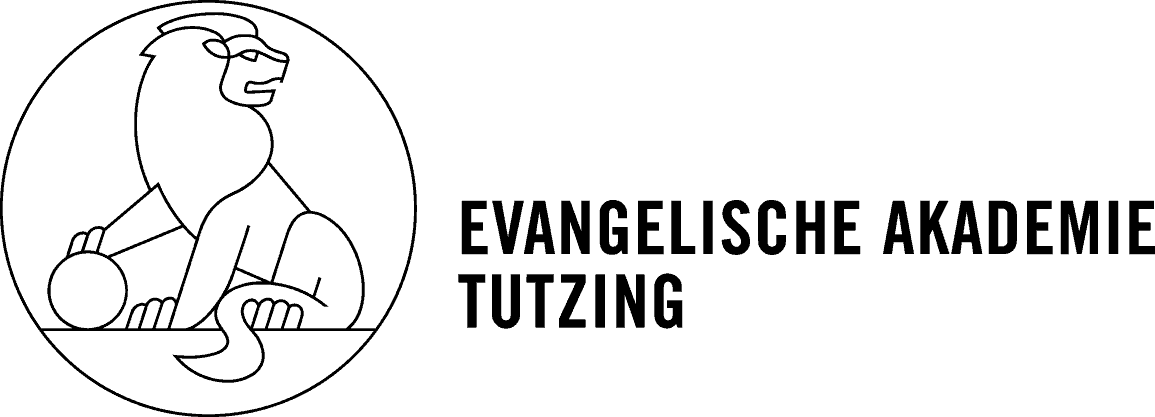Zeit für Zukunft – Tagung mit dem Bund Deutscher Architekten
Zum zweiten Mal nach 2016 luden die Evangelische Akademie Tutzing und der BDA vom 18. bis 20. Januar dazu ein, am Ufer des Starnberger Sees transdisziplinär über Stadt, und Architektur nachzudenken. Der 2016er Titel „Die Stadt als Lebensform“ wurde auch 2019 übernommen, mit Blick auf die großen gesellschaftlichen Probleme unserer Tage aber um den Zusatz „Zusammenhalt“ ergänzt.
Judith Stumptner, die als Studienleiterin der Akademie und Gastgeberin gemeinsam mit Frauke Burgdorff als Moderatorin durch die Tage leitete, führte ein zentrales Thema gleich in ihrer Begrüßung ein, in dem sie konstatierte, dass wir es aktuell mit auseinanderdriftenden Gesellschaftsteilen zu tun haben, die sich zunehmend fragmentieren und selbst die lange gesetzte Idee der einigende Kraft Europas nicht mehr gegeben scheint. Und obschon Frauke Burgdorff nachschob, dass es den einen roten Faden in dieser Tagung eben nicht geben werde, war die Frage nach den Wechselwirkungen zwischen Individuum und Gemeinschaft, zwischen Exklusion und Inklusion, einer von mehreren roten Fädchen, die an unterschiedlichen Stellen verschiedener Vorträge zu Tage traten. Burgdorff hinterfragte weiter, ob wir es bei all dem Alarmismus, den wir von so vielen Seiten hören – und der auch in den Grußworten von BDA-Präsident Heiner Farwick und der Vorsitzenden des BDA Bayern, Lydia Haack, durchaus herauszuhören war – wirklich mit einem tatsächlichen Problem zu tun hätten oder ob nicht doch eigentlich alles verhältnismäßig in Ordnung sei.
Wechselwirkungen zwischen Individuum und Gemeinschaft
Von Kants Diktum der „geselligen Ungeselligkeit“ ausgehend, fächerte Dorn dieses Wechselspiel auf von der Antike, wo die vielzitierte Inschrift „Erkenne dich selbst“ am Apollotempel von Delphi vermeintlich zum ersten Mal auftauche, über Christentum und Protestantismus, die die individuelle Andacht als Weg zu Gott in den Mittelpunkt vieler Praktiken stellten hin zum Auftauchen von detaillierten Porträtdarstellungen in der Renaissance und dem Begriff der „Mündigkeit“ in der Aufklärung. Demgegenüber, so Dorn weiter, stellten der Marxismus ab dem 19. Jahrhundert sowie rechter, völkisch-rassischer wie linker, sozialistischer Totalitarismus „den großen backlash“ des Individuums hin zum „Wir“ einer größeren Menge von Menschen dar. Analog dazu zählte Dorn Möglichkeiten auf, die dem Individuum heute Formen des Zusammenhalts bieten könnten: Blutsbande, Religion, Nation, gemeinsame Geschichte und Kultur, eine äußere Bedrohung, Sympathie und Gleichgesinntheit sowie – vor allem in Bezug auf größere Zusammenhänge – das Hinarbeiten auf ein gemeinsames Ziel. Da der freiheitliche Nationalstaat aber die beste Organisationsform sei, die die Menschheit bisher gefunden habe, sei eine Besinnung auf die Nation die Variante, die vor dem Hintergrund sich zusehends feindlich gegenüberstehender „Communities“ gegeben sei und der Dorn das meiste einigende Potential zusprach.
Das, was im Radsport selbstverständlich erscheint, forderte am folgenden Tag die Soziologin Jutta Allmendinger, indem sie sich für eine systematische Implementierung von Verantwortungsübernahme aussprach. Zuvor hatte der Radprofi Marcus Burghardt verdeutlicht, dass selbst ein Etappensieg bei einer großen Rundfahrt wie der Tour de France nicht möglich sei, ohne dass viele Spezialisten zusammenarbeiteten. Auch wenn am Ende „nur einer auf dem Podium steht“, seien doch die sieben anderen Fahrer eines Teams von entscheidender Bedeutung, um den Siegfahrer auf dem Weg ins Ziel „aus dem Wind zu halten“. Dazu kämen noch die Mitglieder des Teams hinter dem Team: Sportliche Leitung, Trainer, Physiotherapeuten, Masseure, Köche, Mediziner. Dabei sei völlig klar, dass jeder seine ganz individuellen Stärken einbringe für die Arbeit am Erfolg der Mannschaft – auch wenn es nach außen oft so aussehe, als sei Fahrradfahren ein Individualsport.
Soziologin Allmendiger plädiert für verpflichtendes soziales Jahr
Allmendinger also plädierte für eine Systematisierung einer solchen Sammlung individueller Stärken. Ihr schwebten dabei etwa die Einführung eines bezahlten und für alle verpflichtenden sozialen Jahres vor oder den Aus- und Umbau jener Einrichtungen, die sie mit „sozialen Tankstellen“ bezeichnete. Ausgehend von den durch Studien belegten Zahlen, nach denen sich Deutschland zusehends sozio-ökonomisch segregiere, und die Möglichkeiten der Mischung einzelner Gesellschaftsbereiche – durch Begegnung im öffentlichen Raum oder durch Heirat – stetig geringer werden, kämen Orten wie Schwimmbädern, Sportstadien oder Stätten der Erwerbstätigkeit eine größere Bedeutung zu. Sie müssten mit weiteren Funktionen belegt werden, damit sich Alt und Jung, Arm und Reich wieder öfter begegneten. Allmendinger verwies dabei auf die Wichtigkeit von der Mischung der Quartiere: Denn ohne eine solche gesteuerte Belegung von Häusern und Wohnungen könnte der öffentliche Raum die Funktion der Durchmischung in zusehends homogenen Stadtvierteln nicht leisten. Dabei riet sie zum Nudging, einer sukzessiven Verschiebung von Anreizen, um die angestrebten Veränderungen nach und nach einzuführen.
Der Psychologe Jan Kalbitzer arbeitete in der Folge einen für das Handeln des Individuums in der Gesellschaft höchst relevanten Punkt heraus. Die eigene Sicht auf die Dinge sei immer nur eine von vielen, so Kalbitzer, entsprechend sei auch die eigene Verantwortung nur eine kleine. Er wies zudem darauf hin, dass es der Verlust persönlicher Nischen sei – jener Bereich der Rückzugsmöglichkeiten –, der im Menschen Stress auslöse. Für Kalbitzer umfasst das sowohl konkret gebaute Räume wie auch jene Bereiche, in denen sich Menschen kompetent und wohl fühlten. Dieser Stress könne zum einen zu Krankheitsbildern wie Schizophrenie führen, zum anderen aber auch zu einem Mehr an Aggression und Pauschalisierung. Beim Herstellen solcher Räume könnten Architektinnen und Architekten künftig ebenso Abhilfe schaffen wie sie dem digitalen Raum zu mehr Struktur verhelfen könnten. Dieser, so der Psychologe, leide in seiner Architektur nämlich an einem Mangel an Ordnung.
Frank Richter, Theologe und Politiker aus Meißen, gelang es im Anschluss, die Frage nach dem Wohlbefinden des Einzelnen auch die der kleinen und größeren Gruppen innerhalb der Gesellschaft zu stellen. Er mahnte, dass Politik und Gesellschaft die kleinen Gruppen stärken müsse: „Das Gute wächst von unten!“ Für den Zusammenhalt innerhalb dieser Gruppen sorge das geschriebene und gesprochene Recht, die öffentliche Bildung und die freiheitlich demokratische Grundordnung. Dafür aber müssten die Menschen in den jeweiligen Stadtteilen das Gefühl von tatsächlicher Gleichheit auch haben.
Nahtlos daran schloss die Wiener Politikwissenschaftlerin Tamara Ehs mit ihrer Frage an, wer in unserer Gesellschaft durch aktuelle Prozesse wie Wahlen und Partizipation überhaupt gehört würde. In beeindruckenden Zahlen am Beispiel Wiens legte sie dar, dass es vor allem die sozio-ökonomisch gut dastehenden Bezirke der Stadt seien, die über hohe Wahlbeteiligung und großes bürgerschaftliches Engagement verfügten. Bildungsstand und Kaufkraft seien am Ende verantwortlich, ob das Individuum in der Stadtgesellschaft Gehör fände. Auch sie nannte konkrete Maßnahmen gegen politische Ungleichheit. Neben Grundsätzlichem wie der Sicherstellung von Arbeitsplätzen, höherem Bildungs- und Einkommensniveau und einer sozialen Absicherung, wies Tamara Ehs auf die Möglichkeit geloster Stadträte hin – ein Modell, das derzeit erfolgreich in Irland praktiziert würde und durch eine stete Rotation immer wieder anderen Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten die Möglichkeit des Mitgestaltens einräume. Auch eine „Nichtwählerprämie“ könnte ein Ansatz sein. Nach diesem Modell fallen alle Stimmen von Nichtwählern automatisch der stimmstärksten Partei zu. Um einer Wahlniederlage vorzubeugen, so die These, würden die Parteien ihre Bemühungen in Wahlkreisen mit geringer Wahlbeteiligung wohl deutlich intensivieren.
Im Spannungsfeld zwischen Individuum, seinen Egoismen und der Gesellschaft
Fabian Letow, Regisseur und Theatermacher aus Bochum, und der Film „Zeit der Kannibalen“ – über den im Anschluss mit Drehbuchautor Stefan Weigl diskutiert wurde – beleuchteten das Spannungsfeld zwischen Individuum und seinen Egoismen und der Gesellschaft. Matthias Böttger fragte daraufhin aus dem Auditorium, ob es nicht auch Menschen innerhalb der Gesellschaft gäbe, die gar nicht mehr teilhaben und mit den Privilegierten – zu denen alle Anwesenden sich wohl mehr oder minder zählen müssten – nicht zusammenleben wollten. Die Frage sei deshalb, ob Architektinnen und Stadtplaner sich womöglich mitschuldig machten an der Zementierung herrschender Verhältnisse.
Edgar Grande nahm diesen Faden auf und stellte eine Trilogie von Fragen an den Anfang seines Vortrags: Wer soll zusammengehalten werden, wie viel Zusammenhalt benötigen wir und was soll diesen Zusammenhang stiften? Wenn die Zivilgesellschaft dabei Teil der Lösung und nicht des Problems sein soll, so der Politikwissenschaftler, müssten Orte der Begegnung geschaffen werden, zu denen er gemischte Wohnquartiere, Bibliotheken oder Museen zählte. Auch bei Grande tauchte der Begriff der „sozialen Tankstelle“ auf. Dazu müssten „Brücken“ gebaut werden, auf denen man sich treffen könne. Dies könne etwa durch die Einführung eines bezahlten sozialen Pflichtjahrs, durch die Wiederbelebung von Ortskernen oder politische Bildung geschehen. Dazu könne durch bezahlten „Ehrenamtsurlaub“ das ehrenamtliche Engagement gestützt werden – und der gesellschaftliche Zusammenhalt müsse endlich als kommunale Aufgabe begriffen werden: „Im Kern müssen wir den Staat neu denken, wenn wir über die Stärkung der Zivilgesellschaft nachdenken“, so Grande.
Julia Krüger, ebenfalls Politikwissenschaftlerin und engagierte Autorin des Portals netzpolitik.org, fordert dazu auf, die Änderungen, die sich für die Gesellschaft durch die Digitalisierung ergeben, anzuerkennen, diese aber gleichzeitig deutlich zu regulieren. Es gälte, das Potenzial des Digitalen endlich auszuschöpfen und sich die Möglichkeiten nicht von wenigen Firmen diktieren zu lassen.
Die Architektin Anna Heringer schließlich brachte viele der benannten Themen auf einen „kleinsten gemeinsamen Nenner“: Architektur – mit beeindruckenden Projekten, die in Bangladesh ebenso wie in Worms, als Schule, Flüchtlingsunterkunft oder als Altar entstanden und auf nachhaltige Baustoffe wie Holz, Bambus und vor allem Lehm gleichermaßen setzen wie auf die Kraft des gemeinsamen Entstehenlassens eines Werks. Nicht nur, dass so nachhaltiges Bauen im Sinne einer Dekarbonisierung der Architektur möglich ist, auch schafft die Art der Entstehung mit tatsächlicher Partizipation durch Handanlegen während des Baus ein hohes Maß an Identifikation mit der Aufgabe – und dadurch gemeinschaftlichen Zusammenhalt.
Eine neue Form von Soziabilität als Gegenpol zu Extremismus?
Abschließend kann man konstatieren, dass wir es als Gesellschaft mit einigen schwerwiegenden Problemen zu tun haben. Aber, und das machte die Professorin für Entwerfen, Nina Gribat, in ihrem abschließenden Kommentar deutlich, das gemeinsame Arbeiten an diesen Problemen kann jenes Momentum sein, das bei größeren Teilen der Bevölkerung eine Form des Gefühls von Selbstwirksamkeit auslösen. Andreas Denk plädierte in seinem Schlusskommentar vor dem Hintergrund einer Neukalibrierung von Partizipationsprozessen für eine föderale Struktur auf kommunaler Ebene, die es den Menschen, die sich in den Quartieren auch heute schon stark engagieren, genau diese Möglichkeit der Wirksamkeit einräumen könnte. Architektinnen und Stadtplaner hätten dann die Pflicht, die durch eine innigere Verzahnung der Räume – vom kleinsten Zimmer des Individuums bis zum Stadtraum aller auf Straße und Platz – eine detailliert gedachte Folge von Räumen mit Fokus auf die Schwellenräume intensiv zu planen. In diesem Bund aus Quartieren, so Denk, könnte eine neue Form von Soziabilität entstehen, die nicht zuletzt ein schlüssiger Gegenpol zu Extremismus sei.
Frank Eckhart schließlich mahnte, Partizipation, so wie sie derzeit vielerorts betrieben würde, sei einer der Motoren des Auseinanderdriftens der unterschiedlichen Gesellschaftsteile, da sie die Hoffnung auf Wirksamkeit vor Ort schüre und genau diese dann allzu oft bitter enttäusche. So müsse die Politik endlich anfangen, ihre mit diesem Werkzeug der Teilhabe angekündigten Versprechungen ernsthaft einzulösen, wie sie die im Grundgesetz verbriefte „Schaffung gleichwertiger Wohnräume“ priorisieren müsse. Hier würden, so der Soziologe aus Weimar, Stadtteile viel zu oft ungleich behandelt.
Die Qualität dieser gemeinsamen Tagung von BDA und Evangelischer Akademie Tutzing zum „Zusammenhalt“ lag in ihrer Sensibilisierung für Fehlstellen und das Öffnen von Handlungs- und Denkräumen, die an die Stelle vermeintlich klarer Lösungen treten können. In einer multikomplexen Welt können Architekten und Stadtplaner diese Räume mit individuell und graduell angepassten Strategien füllen und so die als gesellschaftlicher Kitt notwendige Wirksamkeit auch wieder für sich selbst entdecken. Es ist wieder Zeit für Zukunft.
Text: David Kasparek / der architekt
Quellenhinweis: Dieser Artikel wurde zuerst auf der Homepage des Bundes Deutscher Architekten publiziert (zum Link). Die Verwendung des Artikels für die Homepage der Evangelischen Akademie Tutzing geschieht unter freundlicher Genehmigung der Seite der architektbda.de.
Bild: Während der Tagung in der „Rotunde“ – dem Auditorium der Evangelischen Akademie Tutzing. (Foto: David Kasparek)