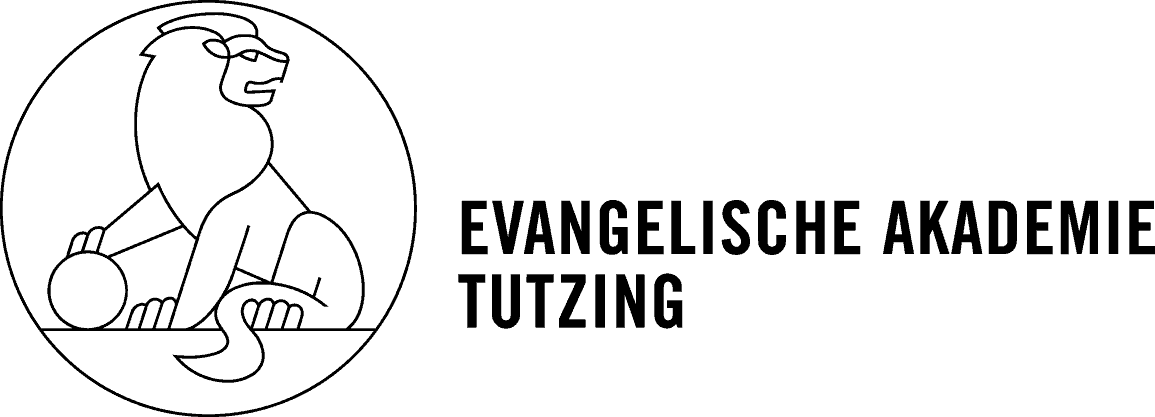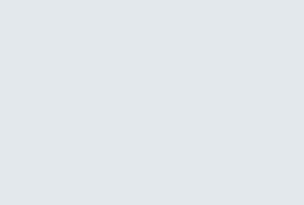Der christliche Glaube versteht sich nicht von selbst. Seine Welt ist er-klärungsbedürftig. Schon die Jüngerinnen und Jünger verstanden die Worte Jesu oft genug nicht. Umso weniger erschließen sich die Vorstellungshorizonte des Christentums in einer immer stärker um sich selbst kreisenden Welt.
Selbst für Christinnen und Christen erklärt sich vieles nicht aus sich selbst: etwa die Pointe der Episode aus dem Lukasevangelium, in der eine „Sünderin" Jesus von Nazareth die Füße salbt. Er stellt sie den Anwesenden danach als Vorbild hin: „Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt; wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig." Wird denn nur denjenigen vergeben, die zuvor kräftig geliebt haben – oder gar kräftig gesündigt? Kann man je nachdem mehr oder weniger vergeben und kann man von der Größe der Vergebung auf die Größe der Sünde und die Liebe einer Person rückschließen? Wie ließe sich das überhaupt messen und erkennen? Und kann man durch Vergebung sogar Liebe fördern?
Sünde, Liebe und Vergebung: Es sind gleich drei zentrale Motive der christlichen Glaubenswelt, drei große Motive des Menschseins an sich, die hier in einem Satz ins Verhältnis gesetzt werden. Welche Vorstellungen vom Menschen, von der Welt und von Gott leuchten sie im Horizont des christlichen Glaubens aus? Wie werden sie in der Gegenwart begriffen und wie könnten sie zu verstehen sein?
Welten des Glaubens – Glauben in der Welt: In der vielschichtigen Dialektik von Welt und Glaube wollen wir uns mit großen Begriffen der christlichen Vorstellungswelt befassen, die zugleich zentral für eine „weltliche" Gegenwartskultur sind: mit der Sünde und der Vergebung, der Freiheit, dem Leben und der Hoffnung. Denn nach wie vor sind es diese Begriffe, die unser Menschsein und Zusammenleben in der Tiefe aufschlüsseln können. Wie kommen Freiheit, Gnade und Pluralismus im politischen Handeln zur Geltung? Wie denken die Naturwissenschaften und wie die Theologie über das Leben nach? Wie können innerweltliche Vergebungspraktiken theologisch angeleitet und eingeordnet werden, ohne dabei überhöht zu werden? Und wenn die ganze Geschichte zu guter Letzt auf ein Gericht zuläuft, das Gerechtigkeit schafft, lässt der Richter schon sehr lange auf sich warten. Kommt er am Ende überhaupt nicht? Oder doch? Ist alles Hoffen am Ende trügerisch, oder ist es gerade die Pointe des Glaubens, mit derartigen Widersprüchen leben zu lernen?
Wir laden Sie herzlich ein, mit uns und unseren Referentinnen und Referenten in ein grundlegendes, kritisches und radikales Nachdenken zu kommen über christliche Glaubenswelten in der Welt von heute.
Dr. Hendrik Meyer-Magister, Pfarrer, Stellvertretender Direktor und Studienleiter für Gesundheit, Künstliche Intelligenz und Spiritual Care an der Evangelischen Akademie Tutzing
Prof. Dr. Reiner Anselm, Professor für Systematische Theologie und Ethik an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München
Prof. Dr. Karsten Fischer, Professor für Politische Theorie am Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München