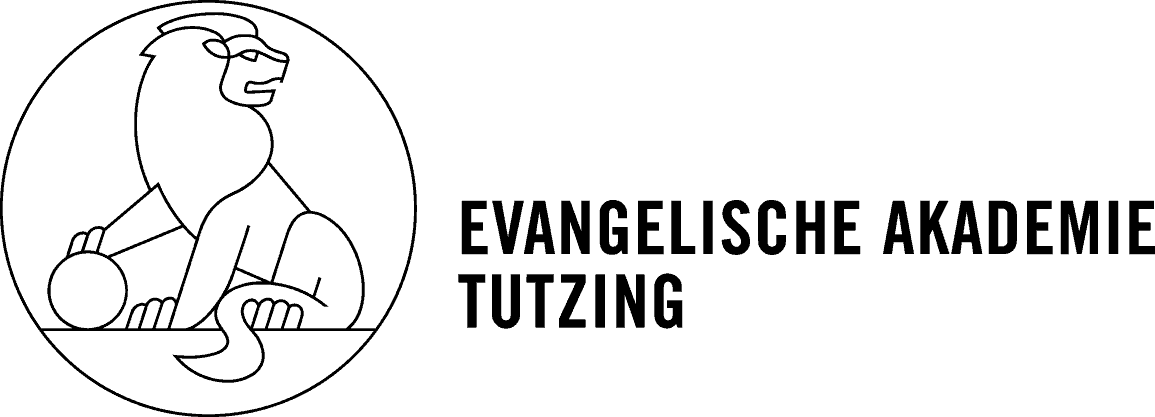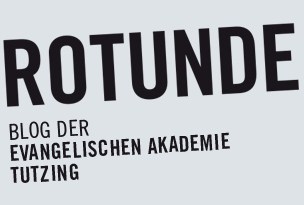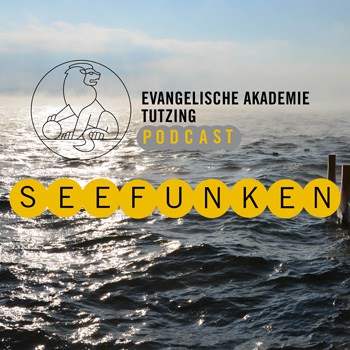Public Intellectual – Zum 95. Geburtstag von Jürgen Habermas
Wie kein anderer beteiligt sich der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas an den gesellschaftspolitischen Debatten. Sein Lebenswerk ist vom Prinzip Verständigung geprägt und vom Nachdenken über Religion. Eine Würdigung von Udo Hahn.
→ Aus unserem Archiv: Neu veröffentlichte Videos aus der Tagung mit Jürgen Habermas im Oktober 2021 finden Sie auf unserem YouTube-Kanal
Substanz und Kontinuität – beides, so könnte man sagen, macht einen “public intellectual” aus. Einen, der in der Öffentlichkeit gehört wird, der wirklich etwas zu sagen hat. Der Sozialphilosoph Jürgen Habermas gehört zweifellos in diese Kategorie. Seit Jahrzehnten mischt er sich mit provozierenden Gedanken in die großen Debatten ein. Sein Werk versteht er, der am 18. Juni 95 Jahre alt wird, nach wie vor als “work in progress”, wie er sagt. Schon klar: Mit dem Weltgeschehen wird er nie fertig werden.
Als Vordenker fordert er heraus. Dabei sind seine Einlassungen von einer durchaus idealistischen Sicht geprägt: dass am Ende der zwanglose Zwang des besseren Arguments überzeugt. Habermas ist nicht naiv, denn Mächtige verzichten nicht auf ihre Ansprüche und Narzissten lassen sich vom Widerspruch ohnehin nicht beeindrucken. Gute Argumente, die machen aber seit jeher die Widerstandskraft der Unbeugsamen aus und entlarven Mächtige wie Narzissten, die sich dem Diskurs verweigern und nur eine Botschaft kennen: die eigene.
Dass sich Jürgen Habermas auch religiösen Themen widmet, ist keine Alterserscheinung. “Ich bin alt, aber nicht fromm geworden”, warnt er vor falschen Schlussfolgerungen. Sein Interesse an Religion ist wissenschaftlich und nicht spirituell. In seinen frühen Werken, etwa in der 1981 erschienenen “Theorie des kommunikativen Handelns” geht er noch von einem allmählichen Verschwinden von Religion aus. Je mehr die Säkularisierung voranschreitet desto mehr werde Religion überflüssig. Von dieser These hat er sich längst verabschiedet. Religion bleibt für ihn ein wichtiger Faktor in der Gesellschaft.
Seine Begründung: In einer “entgleisenden Moderne” braucht es Ressourcen, die für Zusammenhalt sorgen. Er spricht sogar von einer “gemeinsamen Vernunft” von Gläubigen, Ungläubigen und Andersgläubigen, wechselseitige Lernprozesse eingeschlossen.
Mit dem evangelischen Theologen Wolfgang Huber könnte man sagen, dass die Entwicklung Habermas Gründe liefert, “dass die Gegenwart auf die Ressourcen der Welterschließung und der Identitätsstiftung angewiesen bleibt, die in den Religionen tradiert und erneuert werden”. Diese Ressourcen seien nicht nur starke Quellen gelebter Solidarität, “sie enthalten zugleich – gerade in dem Glauben an den einen Gott, vor dem alle Menschen gleich sind – eine Grundlage für eine radikal verstandene Gleichachtung aller und damit eine wichtige Basis für ein inklusives Verständnis der Menschenrechte”.
In seiner Dankesrede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2001 überrascht Jürgen Habermas mit seiner Einschätzung wir lebten in einer “postsäkularen” Gesellschaft, in der es neue Allianzen zwischen säkularer Vernunft und Religionen brauche. Eine Bedeutungszunahme der Religion sieht er damit nicht. Habermas ist also nicht plötzlich fromm geworden. Aber die säkulare Gesellschaft sollte sich Offenheit für die Kraft des Religiösen bewahren. In seiner Rede – wenige Wochen nach den islamistischen Terroranschlägen des 11. September – bezieht er sich auf eine bestimmte Ausprägung von Religion: “Aus der Sicht des liberalen Staates verdienen nur die Religionsgemeinschaften das Prädikat ‘vernünftig’, die aus eigener Einsicht auf eine gewaltsame Durchsetzung ihrer Glaubenswahrheiten und auf den militanten Gewissenszwang gegen die eigenen Mitglieder, erst recht auf eine Manipulation zu Selbstmordattentaten Verzicht leisten.”
In seinem 2019 erschienenen 1.700 Seiten umfassenden Werk “Auch eine Geschichte der Philosophie” deutet er ganz am Ende, auf der vorletzten Seite, seine Motivation an, sich mit der Bedeutung von Religion zu beschäftigen. Es gebe einen rätselhaften Satz von Theodor W. Adorno, “der mich seit langem fasziniert”, schreibt er und zitiert diesen: “Nichts an theologischem Gehalt wird unverwandelt fortbestehen; ein jeglicher wird der Probe sich stellen müssen, ins Säkulare, Profane einzuwandern.” Am Leitfaden dieses Satzes, so erläutert Habermas, habe er versucht, diesen Prozess der Einwanderung theologischer Gehalte ins profane Denken als einen “philosophisch nachvollziehbaren Lernprozess” darzustellen. Die säkulare Moderne habe sich aus guten Gründen vom Transzendenten abgewendet, aber die Vernunft, so der Philosoph, würde mit dem Verschwinden jeden Gedankens, der das in der Welt Seiende im Ganzen transzendiert, selber verkümmern. Dabei beanspruche der Ritus, die Verbindung mit einer aus der Transzendenz in die Welt einbrechenden Macht herzustellen. “Solange sich die religiöse Erfahrung noch auf diese Praxis der Vergegenwärtigung einer starken Transzendenz stützen kann”, so endet Habermas’ Werk, “bleibt sie ein Pfahl im Fleisch der Moderne, die dem Sog zu einem transzendenzlosen Sein nachgibt – und so lange hält sie auch für die säkulare Vernunft die Frage offen, ob es unabgegoltene semantische Gehalte gibt, die noch einer Übersetzung ‘ins Profane’ harren.”
Mit anderen Worten: Religiöse Erfahrung bleibt für ihn solange relevant, solange sie verknüpft ist mit einer lebendigen religiösen Praxis. Solange Menschen religiöse Rituale feiern, solange sie dabei die Erfahrung einer Berührung mit dem Transzendenten machen, bleibt die Frage offen, ob die Religion der säkularen Vernunft etwas zu bieten habt. Damit liegt die Beweislast bei allen, denen ihr Glaube etwas bedeutet. Für ihn selbst bleibt Religion bis heute “opak”, wie er schreibt, dunkel und undurchsichtig. Ob es so bleibt, wer weiß?
2021 ehrte die Evangelische Akademie Tutzing Jürgen Habermas mit dem “Tutzinger Löwen”. Sie würdigte mit dem Preis sein “Eintreten für die Gleichheit aller und die Freiheit jedes Einzelnen sowie für die Demokratie”. Durch seine politischen Interventionen unter der Leitfrage, was wir tun sollen, um gut und gerecht miteinander leben zu können, präge er den öffentlichen Diskurs in Deutschland bis heute. Sein Denken strahle “die Zuversicht aus, dass Verständigung und Konsens in einer Form des Gesprächs möglich sind, die auf den Austausch divergierender Geltungsansprüche und die Kraft des besseren Arguments vertraut”. Darüber hinaus signalisiere sein Engagement für einen intensiveren Dialog zwischen Glauben und Wissen, “dass sich eine säkularisierte Gesellschaft der Perspektive der Religion nicht verschließen darf”.
Der Autor ist Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing.
Bild: Jürgen Habermas im Oktober 2021 in der Evangelischen Akademie Tutzing (Foto: dgr/eat archiv)