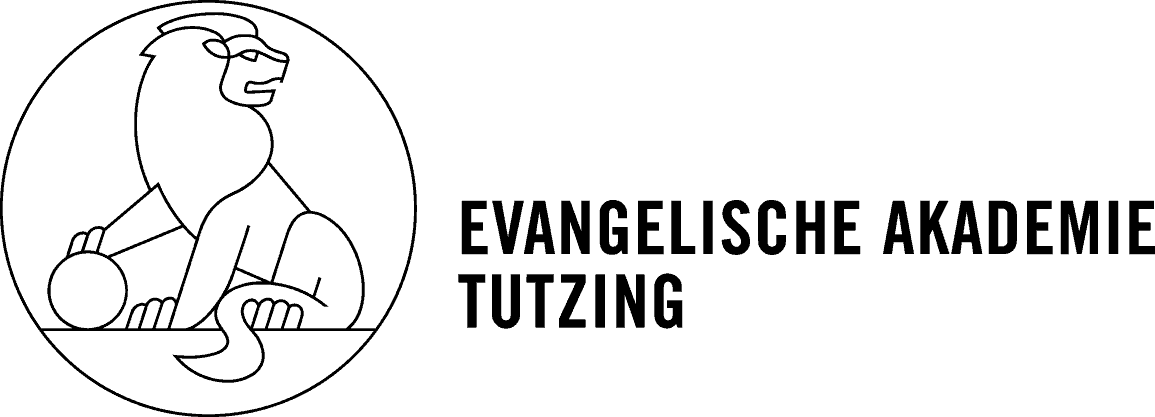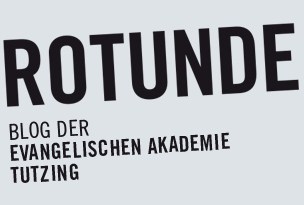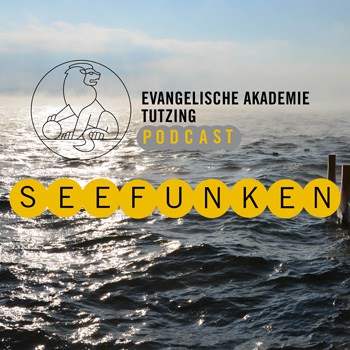Leihmutterschaft im Diskurs
Auf der Tagung “Eine Mutter leihen?” dachten wir im Mai 2024 über neue Familienformen nach, die durch Leihmutterschaft entstehen könnten. David Samhammer, Kooperationspartner der Veranstaltung, stellte nun auf der Frühjahrstagung der Akademie für Ethik in der Medizin am 13. März 2025 Überlegungen dazu vor. Seine Frage: Welches gesellschaftliche Problem löst Leihmutterschaft?
– Keines. So lautet die knappe und in der Kürze provokative Antwort, die David Samhammer, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt “Leihmutterschaft – Über Anfang und Ende des Lebens als gesellschaftspolitische Herausforderung” am Sozialwissenschaftlichen Institut (SI) der EKD, und Professor Dr. Peter Dabrock, Professor für Systematische Theologie (Ethik) an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, in einem Beitrag in der Zeitschrift Medizin-Ethik-Recht (2/2024) ausführen. Beide waren Kooperationspartner und Mitveranstalter des Symposiums “Eine Mutter leihen? Familienformen neu denken”, das am 6./7. Mai 2024 im Rahmen der Veranstaltungsreihe “Leihmutterschaft im Diskurs” in der Evangelischen Akademie Tutzing stattfand (einen vollständigen Bericht über die Reihe können Sie hier abrufen). David Samhammer stellte die gemeinsamen Überlegungen mit Peter Dabrock jüngst auf der Frühjahrstagung der Akademie für Ethik in der Medizin (AEM) vor.
Sie argumentieren, dass eine Legalisierung der Leihmutterschaft in Deutschland in einer ethisch verantwortbaren Form zwar grundsätzlich denkbar sei, aber weder könne Leihmutterschaft das gesellschaftliche verbreitete Problem ungewollter Kinderlosigkeit wirklich lösen noch heteronormative Familienvorstellungen überwinden helfen.
Bei einer Leihmutterschaft trägt eine Frau für eine andere ein Kind aus. Sie ermöglicht damit biologisch oder sozial ungewollt kinderlosen Menschen die Chance auf ein eigenes Kind. In Verbindung mit reproduktionsmedizinischen Methoden sind die Konstellationen hier denkbar vielfältig. Ein Kind aus einer Leihmutterschaft kann mit der Leihmutter und/oder seinen Eltern bzw. einzelnen Elternteilen genetisch verwandt sein, muss es aber nicht. Dadurch entstehen neue soziale Familienkonstellationen, in denen sich Eltern mit ihren Kindern aus Leihmutterschaften, deren Geschwister, seien es nun ebenfalls Kinder aus Leihmutterschaften oder nicht, den jeweiligen Leihmüttern selbst und unter Umständen etwaigen Gametenspender:innen wiederfinden. Leihmutterschaft pluralisiert damit zweifelsohne gleichermaßen die Wege, auf denen eine Familiengründung mit Hilfe Dritter möglich ist, als auch die daraus resultierenden Familienkonstellationen selbst. Während Verfechter:innen der eher traditionellen Kleinfamilie daher eine Krise oder gar die Auflösung der Familie befürchten, sprechen umgekehrt die Kritiker:innen eines repressiven, heteronormativen Familienbildes, gar von einem hoffnungsvollen Weg, durch Leihmutterschaft die heteronormative Kleinfamilie ganz zu überwinden und Reproduktion zu vergesellschaften.
Samhammer und Dabrock argumentieren nun, dass diese Hoffnungen trügerisch sind. Denn solange Leihmutterschaft einerseits viel Geld kostet, wird sie ein Mittel- und Oberschichtenphänomen in den westlichen Gesellschaften bleiben. Sie wird zweifelsohne einzelnen Menschen und Paaren den Weg zum Kind eröffnen, aber nicht in der Breite ungewollte Kinderlosigkeit bearbeiten können. Andererseits sind Leihmutterschaftsfamilien durchaus Familie in einem modernen Sinne, wenn diese als Konstellation von mindestens zwei Personen gefasst wird, die in einem Generationsverhältnis stehen. Zwar erweitert Leihmutterschaft das “Bild der bürgerlichen Kleinfamilie”, so die Autoren, zugleich erscheint Leihmutterschaft aber “auf absehbare Zeit nicht in der Lage, die Familienlandschaft signifikant zu verändern.” Denn Leihmutterschaftsarrangements sind Ausdruck des Wunsches von Menschen, als Familie zu leben, und bleiben normativ auf Familienvorstellung bezogen, die “durchaus an der Norm einer modernen und pluralisierten Kleinfamilie orientiert” sind. Leihmutterschaftsfamilien sind, so Samhammers und Dabrocks nachvollziehbare These, “gerade durch die auf ihre Praxis zurückzuführenden neuen Beziehungsstrukturen” darauf angewiesen, “sich als Familie inszenieren und je nach kulturellen und moralischen Vorstellungen Familienbeziehungen aushandeln zu können.” In Summe bestätigen Leihmutterschaften – gewissermaßen contraintutitiv – so “eher derzeitige Familienmodelle, als sie grundsätzlich in Frage zu stellen.”
Anlass für die vertiefte Beschäftigung mit dem Thema Leihmutterschaft im Rahmen der genannten Veranstaltungsreihe “Leihmutterschaft im Diskurs” zusammen mit der Evangelischen Akademie zu Berlin und dem Zentrum für Gesundheitsethik Hannover, aber auch im Kammernetzwerk und im Forschungsprojekt des SI der EKD war die von der vorherigen Bundesregierung eingesetze Kommission zur Reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, die laut Koalitionsvertrag den Arbeitsauftrag hatte, u.a. die Legalisierung der altruistischen, also nicht kommerziellen, Leihmutterschaft zu prüfen. Derzeit sind Leihmutterschaften in Deutschland verboten. Sie kann aber im Ausland, etwa in Indien, der Ukraine oder in der USA, durch die Vermittlung von Agenturen in Anspruch genommen werden. Hierbei fließen oft hohe Geldbeträge, die zu großen Teilen den Agenturen aber nicht den Leihmüttern zu Gute kommen.
In ihrem Bericht, den die Kommission im April 2024 vorlegte und den die AG-Leiterin Professorin Dr. Friederike Wapler “druckfrisch” in Tutzing präsentierte, hält die Kommission die Legalisierung in klaren und engen Rahmenbedingungen für möglich. Zusammen mit Peter Dabrock sprach sie in Tutzing unter anderem mit Jutta Prediger für “Bayern 2 debattiert” über die Frage.
Dr. Hendrik Meyer-Magister
Stellvertretender Akademiedirektor & Studienleiter für Gesundheit, Künstliche Intelligenz und Spiritual Care
Publikationen zum Nachlesen:
- Zusammenfassender Bericht über die Veranstaltungsreihe “Leihmutterschaft im Diskurs” hier nachlesen
- Zeitschrift für Medizin, Ethik, Recht (Ausgabe 2/2024) hier als PDF abrufen
Hinweis:
Mit den Themen Geburt, Elternschaft und Kinderwunsch beschäftigt sich auch die Tagung “Leben geben: Anfänge zwischen Wunsch und Wirklichkeit” vom 19. – 20. Mai 2025. Einzelheiten zu Programm und Anmeldemodalitäten finden Sie unter diesem Link.
Bild: Podiumsdebatte während der Tagung “Eine Mutter leihen?” im Mai 2024 (Foto: eat archiv)