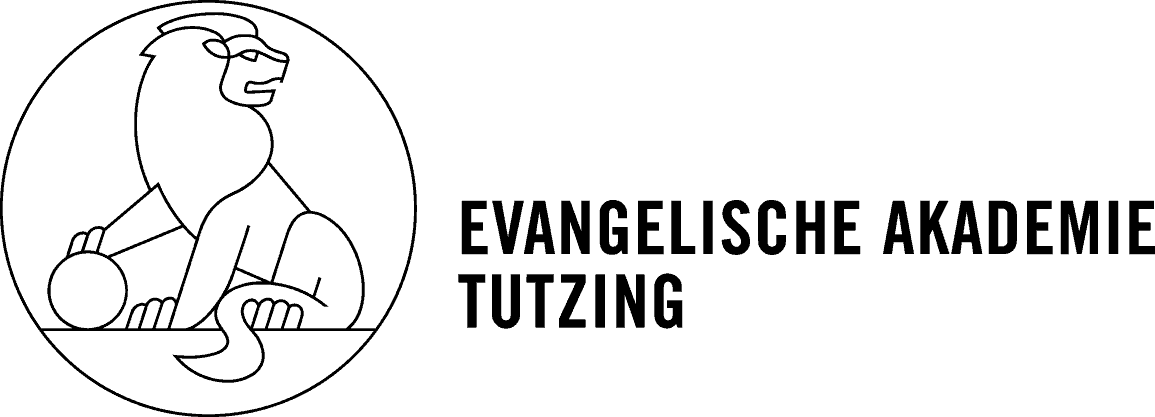„Ihr Realismus ist mit dem Märchen und der Groteske im Bunde“
Laudatio von Dr. Jens Bisky, Autor und Feuilletonist der Süddeutschen Zeitung, zur Verleihung des Marie Luise Kaschnitz-Literaturpreises an die Schriftstellerin Angelika Klüssendorf am 19. Mai 2019 in Tutzing.
Damen und Herren, liebe Frau Klüssendorf,
vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, etwas über ein Werk zu sagen, das mir besonders nah ist, obwohl ich die Autorin nicht persönlich kenne oder doch nur so gut und so schlecht wie jeder andere Leser auch. Ich will nicht über ihre Theaterstücke sprechen. Leider habe ich weder die Farce „Frag mich nicht, schieß mich tot“ noch den Monolog „Branka“, der derzeit in Frankfurt am Main gespielt wird, auf der Bühne gesehen. Ich will zeigen, wie viele Spannungen, wieviel Anarchisches, Sinnliches, wieviel Glanz, wieviel Vergnügen die Erzählungen und Romane der Preisträgerin bereithalten, obwohl Gewalt, Leid, Ohnmacht einen großen Raum darin einnehmen.
Angelika Klüssendorf erzählt des Öfteren vom Essen, sei es von den gutgewürzten Buletten und den Würsten der Imbissbesitzerin Else, sei es vom Appetit der frisch vermählten Katharina, die auf ihrer Hochzeitsreise in nur zwei Tagen folgendes zu sich nimmt: „Burger mit Barbecue-Sauce, Schweinefleisch-Burger, Doppel-Crispy-Chicken-Burger“ und einen „Giant-Burger“, den sie ganz vertilgt.
Während ihr Mann nach dem Frühstück duscht, isst sie die Reste von seinem Teller und sie kann ihn auch überreden, „danach noch Apfelstrudel und Häagen-Dazs-Eiscreme zu bestellen“. Aber all das sättigt nur vorübergehend. Sie habe, sagt Honeymoon-Katharina bald schon vergnügt „Appetit auf Truthahn, einen ganzen natürlich“. Ein „großes Steak“ wäre auch willkommen, ferner „Sauerkraut, Würstchen“, ein „Becher Erdbeereis“. Auf dem Flug nach New York, wohin das Paar weiterreist, begnügt sie sich mit „Käse-Enchiladas, Tortillas, Chili-Burritos und Guacamole-Chips“, sie trinkt dazu mehrere Flaschen Cola.
Immer wieder schildert die Menschenkennerin Klüssendorf die Freuden der Gefräßigkeit, die Lust, sich etwas in den Mund zu stopfen, es herunter zu schlingen. „Jetzt wird erst mal gegessen“, sagt ein glatzköpfiger Riese im Roman „Alle leben so“, und fragt dann „Eier und Speck?“. Ein Vegetarier verliebt sich in eine Frau aus einer Metzgerei, eine Fleischverkäuferin, kauft fortan Knochen sowie blutige Fleischstücke, die er am Stadtrand an herumstreunende Hunde verfüttert, bis die Fleischereiangestellte, von seiner Aura, seinem Selleriegeruch, angezogen, sich in eine Bar einladen lässt. Sie kippen Wodka, wie absichtslos nimmt die Begehrte eine Blume aus der Vase und beginnt, was sonst?, die Blume zu essen.
Im Jahr, in dem Angelika Klüssendorf geboren wurde, verschwanden die Lebensmittelkarten endlich auch aus dem DDR-Alltag. Die Nachkriegszeit war zu Ende, die Menschen in Ost wie West hungerten nicht mehr, aber in Klüssendorfs Erzählungen und Romanen begegnet man dem Titel „Hunger“ gleich an zwei Stellen und öfter noch einer ungeheuren Ess-Gier. Sie hat wenig mit dem Trend zur Kultivierung gemeinsam, mit bewusster Ernährung, gesetztem Essen, zelebrierten Mahlzeiten oder gar Gourmandise. Im Gegenteil. Der Hunger behält in diesem Werk seine elementare Kraft.
Ess-Kultur dagegen ist ein Krisensymptom, wo sie auftaucht, sind finale Zerwürfnisse nicht weit. In der Erzählung „Sehnsüchte“ berichtet Imbissbesitzerin Else, wie Artur ihr ein schönes Leben plant und verspricht: „mein süßes hascherl montag gibt es saltimbocca dienstag cowboysteak mittwoch deine geliebte kleine sülze ich werde dir den gaumen kitzeln“. Von nun an wird die Beziehung immer stumpfsinniger, Else wütend auf die „verdammte kocherei“.
Im Roman „Jahre später“ lebt das Mädchen April zum zweiten Mal mit ihrem Chirurgen Ludwig zusammen, der zwar darauf bestanden hat, Heiligabend entspannt, mit Kartoffelsalat zu verbringen, dann aber doch, er kann es nicht lassen, einiges aus dem KaDeWe anschleppt: „Belugakaviar, Blinis, frische Kirschen, eine Flasche Petrus“. Hilflos, zornig muss er einsehen, dass „ihr der Kaviar egal ist und ihr Gaumen einen so kostbaren Wein gar nicht würdigen kann“. Das Paar bewegt sich schon wieder in alten Gleisen, die ins Langweilige, ins tote Leben führen, in die Entfremdung.
Einmal greift April ein paar Flaschen Wein, die in der gemeinsamen Wohnung herumstehen, will sie mit Freunden beim Rumlungern im Stadtgrün am Ufer der Spree kippen. Da ein Korkenzieher fehlt, wird der Korken mit Kraft in die Flasche gedrückt. Später stellt sich heraus, dass Weine wie dieser sündhaft teuer, nur auf Auktionen zu beschaffen sind. Es zeichnet April aus, dass sie derlei nicht beeindruckt. Sie misstraut den vorgefertigten Erlebnissen wie dem demonstrativen Konsum. Deswegen zieht es sie nach Berlin, wo eine Frau auf dem Fahrrad nur eine Frau auf dem Fahrrad ist, während sie in Hamburg sofort taxiert wird: „Status, Alter, Schönheit“.
In Angelika Klüssendorfs Werk haust eine Sehnsucht nach Unmittelbarkeit, nach einem Dasein, in dem die Dinge einfach sind, was sie sind: Brot, Bier, Liebe, Würstchen, Familie. Schon in dieser Schlichtheit scheint das Leben kompliziert genug. April etwa fühlt sich in konventionellen Situationen, geregelten Abläufen seltsam fremd, unwohl, überfordert. Es wirkt, als wolle sie das soziale Miteinander – Begegnung, Kommunikation, Zusammensein – jedes Mal neu erfinden, aus dem Augenblick heraus erschaffen. Die Routinen, die Verhaltenssicherheit bieten, verunsichern sie, lösen Fluchtreflexe aus. So zielt ihr Lebenshunger nicht auf Verfeinerung, die gekonnte, maßvolle Variation bewährter Muster. Stattdessen müssen Lüste befriedigt oder beruhigt, Ängste gestillt, das Ich erst einmal im eigenen Körper heimisch werden.
Wenn es auch nicht in erster Linie um feine Unterschiede geht, so verbindet sich dieser Lebenshunger doch mit sozialen Interaktionen und kulturellen Überhöhungen. Aber diese sind existenzielle Erfahrungen, notwendig, um sich überhaupt erst ein Leben zu erkämpfen. Als das Mädchen noch nicht einmal Rippchen heißt, geschweige denn April, erobert es sich eine neue Rolle in der Kinderheimgesellschaft, indem es sich gegen einen behauptet, der einen ähnlichen Hunger hat wie sie, in dessen Mund „Kartoffeln, Fleisch, Wurstbrote“ blitzschnell verschwinden und der, ein kräftiger Fettsack, dann anderen den Nachtisch abpresst, Pudding oder Götterspeise. „Als August Kreische das nächste Mal ihren Nachtisch einfordert, ist sie fest entschlossen, sich das nicht gefallen zu lassen. Ruhig sieht sie ihm entgegen, duckt sich weg unter seiner Faust, nutzt seine Überraschung und springt ihn an. Sie reißt an seinen Haaren, kratzt, spuckt, pariert seine Schläge. Ihr Atem geht wild …“ Sie gewinnt ein Dessert und ein besseres Ansehen bei den Heimkindern. Den Triumph zu krönen, steigt sie in die Speisekammer ein, was ihr gelingt, weil sie so dünn ist, und verteilt die schlichten Köstlichkeiten: „Schokolade, Bonbons, Kokosflocken, Geleeschnitten, Kekse“, dann Zwieback und Obst.
Das Mädchen verschlingt auch Bücher, versteht seine eigenen Erfahrungen und Gefühle dank der fremden Geschichten. Mit Edmond Dantes, der von Kindheit an zu kämpfen gewohnt war, lernt es Überlebenswillen und Zorn. Für die Lust am Essen steht „Das kluge Gretel“, eine subversive Figur der Grimms, eine Märchen-Rebellin.
Das Gretel war Köchin, ging gern in Schuhen mit roten Absätzen. „Es trug sich zu“, dass ihr Herr einen Gast erwartete, zwei Hühner sollte sie richten und tat es, bis diese fein gar und braun waren. Doch der Gast ließ auf sich warten. Der Herr ging, ihn zu holen, Gretel blieb mit den Hühnern am Bratspieß allein zurück, und weil sie schwitzte, sprang sie in den Keller, nahm einen Schluck Wein, dann noch einen, dann bestrich sie die gebratenen Hühner mit Butter, und weil der Braten so gut roch, überredete sie sich, ihn zu probieren: „Ei, was sind die Hühner so gut! Ist ja Sünd und Schand, daß man sie nicht gleich isst!“ So griff sie zu, aß erst einen Flügel, dann den anderen, rasch war ein Huhn verspeist. „Hei, Gretel“, sprach sie zu sich selbst und trank noch eins, „wo das ist, muß das andere auch sein, die zwei gehören zusammen: was dem einen recht ist, ist dem anderen billig …“. Sie hatte auch das zweite Huhn verspeist, als der Herr zurückkam und sagte, sie solle sich sputen, gleich erscheine der Gast. Er wolle derweil schon das Messer zum Zerteilen der Hühner wetzen. Das kluge Gretel wusste sich zu helfen, passte den Gast an der Tür ab, warnte ihn, ihr Herr wolle ihm beide Ohren abschneiden, sagte dem Herrn, der Gast habe beide Hühner genommen und sich mit ihnen aus dem Staub gemacht. Nun rannte der Gast davon, der Herr, das Messer in der Hand, stürmte hinterher und rief „Nur eins, nur eins“. Er dachte dabei an die Hühner, der Gast an seine Ohren, von denen er eines hergeben solle, und er lief, schließen die Grimms, „als wenn Feuer unter ihm brennte, damit er sie beide heimbrächte“.
Wilhelm Grimm hat die Erzählung von der verführerischen Wirkung des Bratendufts in einem katholischen Predigtbüchlein des frühen 18. Jahrhunderts gefunden. Für die Kinder- und Hausmärchen strich er mit Hilfe seines Bruders Jacob die moralische Nutzanwendung und erfand die Ausreden hinzu, mit denen Gretel sich selbst überzeugt, dass es besser sei, den Wein nicht im Keller und die Hühner nicht dem Herrn zu lassen. Die Gier aufs Leben braucht Geschichten, sowohl Anstrengungen der Selbstüberredung als auch Ausflüchte, und beides verändert die Welt im Handumdrehen, bringt Durcheinander, wenigstens ein Stocken, Ruckeln im gewohnten Lauf der Dinge. Rasch ist allen, als wenn Feuer unter ihnen brennte. Das Gretel mag noch manchen Braten schmausen, jeder Schluck Wein sei ihr gegönnt, aber es fällt doch schwer, sich ein glückliches Ende als Gattin für sie vorzustellen, gleichgültig, ob in der Ehe mit dem Herrn, dem Gast oder einem Prinzen.
In Rezensionen der Klüssendorfschen Bücher fallen gelegentlich große Namen, Franz Kafka, William Faulkner, Alice Munro. Mir erschließt das „kluge Gretel“ dieses Werk leichter, zwangloser. Das Mädchen spielt ja mit den roten Lackschuhen der Mutter. Und ist nicht Ludwig, von dem es heißt, er müsse „den Grund unter sich in einen brodelnden Abgrund verwandeln“, ein enger Verwandter der klugen Märchen-Köchin? Und führt nicht das Gretel-Modell mit der Verschwisterung von Appetit und Fiktion, Einbildung, Trieb und Notlüge, sofort auf das grundlegend Subversive, das bedrängend Sinnliche, das Erfinderische und Kluge dieser Prosa? Sie hat jedenfalls einige Eigenschaften, die selten sind in der deutschen Gegenwartsliteratur und manche einzigartige.
Das beginnt mit den anarchischen Motiven der Figuren. Sie wollen oft ausbrechen, entkommen. Ihre Gier nach Leben ist „Gier nach einem anderen Leben“, von dem sie selbst nicht wissen, wie es aussehen soll. So geht es zumindest einer Mutter im Erzählungsband „Aus allen Himmeln“. Andere, wie der Gerichtsvollzieher in „Alle leben so“ planen zu detailliert oder verstricken sich, wie der Heiratsschwindler, in ihren eigenen Illusionen und Lügengespinsten. Es geht nicht ohne den Wunsch nach Normalität, aber in der Normalität ist es schwer auszuhalten. Daher fallen Klüssendorfs Menschen immer wieder ins Wilde, Chaotische, so sehr sie sich auch um Ordnung, Heim, Geborgenheit bemühen. Ihren Protagonisten ist das Unglück der Welt in die Glieder gefahren. Sie wünschen Stabilität, Verlässlichkeit und stolpern dabei von Ungeschick zu Ungeschick. Dieses Stolpern, Straucheln, Haltsuchen ist ihr Leben.
In der deutschen Gegenwartsliteratur dominiert die Perspektive der Mittelschichten. Nicht so bei Klüssendorf. Sie erzählt von unten, von Außenseitern, mal mit plebejischem Witz, mal mit rebellischer Kraft. Gretels Stärke liegt darin, dass sie die Spielregeln ändert. Sie ist eine Figur der radikalen Subjektivität, des Eigensinns. Er bestimmt die Perspektive der Angelika Klüssendorf. Ihr Realismus ist mit dem Märchen und der Groteske im Bunde.
Aber wichtiger noch als der klare Blick auf die Verlorenheit der Individuen, gleichviel ob Frauen oder Männer, auf die Unerfüllbarkeit der Sehnsüchte und das Amateurhafte unseres In-der-Welt-Seins ist die Art, wie Angelika Klüssendorf davon erzählt. Karg, lakonisch, schnörkellos, präzise hat man ihre Prosa genannt. Das stimmt, trifft aber nur halb. Das feine Lob würde Wesentliches verschatten, sagte man nicht sofort hinterher, dass diese Autorin ungeheuer anschaulich und sinnlich schreibt, Emotionen, Gedanken, Charakterzüge körperlich werden lässt. Ihre Menschen essen nicht nur viel, sie schmutzen, sie riechen, sie schlagen, sie quälen andere oder ihren eigenen Leib, gegen den sie aufbegehren, weil er ihnen kein Zuhause ist.
Sie alle kennen den inzwischen berühmten ersten Satz der Romantrilogie, der auch der letzte ist. „Scheiße fliegt durch die Luft“. Darin liegt Geruch, Farbe, Action. Auch das gehört zur Sinnlichkeit dieser Prosa, dass sie nicht auf der Stelle tritt, selbst Langeweile als Sequenz von Handlungen schildert. Nehmen sie nur das erste Kapitel des Romans „April“: „Die junge Frau klingelt an der Wohnungstür im Erdgeschoss“. Wir lernen Fräulein Jungnickel, ihren Vogel und ihren Reinlichkeitsfimmel kennen. April kocht eine Tütensuppe, verrichtet ihre Morgentoilette, nimmt im „VEB Kombinat Starkstromanlagenbau Leipzig“ eine Arbeit auf, kauft sich von ihrem ersten lohn einen Plattenspieler und eine illustrierte Ausgabe der Märchen der Gebrüder Grimm, sie heizt, verursacht einen Wohnungsbrand, verliert, „was sie an die Vergangenheit bindet“, feiert mit Freunden aus ihrer alten Clique, einer küsst hart und trocken, einer schaut nackt bei der Vermieterin Jungnickel vorbei, irres Gekreisch und Gezeter sind zu hören. April traut sich nicht auf den Flur. Das ist, mit mancher Auslassung, das Geschehen auf den ersten, knapp elf Seiten. Angelika Klüssendorf erzählt flink, als wolle sie keine Zeit verlieren. Ihr reichen zwei, drei Sätze, einen Schauplatz heraufzubeschwören, ein Absatz, Spannung aufzubauen und wieder zu lösen, wenige Details, eine Person unverwechselbar zu charakterisieren. Es stimmt schon, dass sie die Wörter nicht verschwendet, nicht zu viele macht, aber sie geizt nicht mit Eindrücken, Geräuschen, Figuren, Geschehnissen. Auf die unvermeidliche Frage nach autobiografischen Motiven in ihrem Werk hat sie einmal schlagfertig geantwortet, sie könne halt sehr gut authentisch schreiben. In der Tat kann man die Kunst, authentisch zu wirken, an ihrer Prosa besser studieren als an vielen Reportagen, die Lebensnähe mit Floskeln und Klischees vorgaukeln. Angelika Klüssendorfs Erzählungen bestechen durch Intensität. Ihre Formulierungen sitzen, sind also unverbraucht und spreizen sich nicht. Aber manche sind so einleuchtend, dass man beim Lesen leise applaudieren möchte: „in ihrer Seele“, heißt es, um ein Beispiel zu geben, „in ihrer Seele sitzt ein Orchester aus beschädigten Spielern, die nur auf ihren Einsatz warten“.
Angelika Klüssendorf hat nicht immer so authentisc geschrieben wie in der Geschichte des Mädchens, das sich herauskämpft, einmal, zweimal, dreimal befreit, Schriftstellerin wird und im Schreiben die Verlässlichkeit finden könnte, die ihr Mutter und Vater nicht boten. Kraftvoll, sinnlich, lebenswahr sind auch die frühen Erzählungen, aber in ihnen ist die Absicht und daher auch die Komposition eine andere. In „Sehnsüchte“ spielt die Autorin mit mehreren stimmen und Perspektiven, im Roman „Alle leben so“ betrachtet sie das Räderwerk der Gesellschaft aus der Sicht von Sonderlingen, die doch sind wie du und ich. Ein Schriftsteller tritt auf, der unfähig ist, alltägliche Begebenheit zu beschreiben. Am Ende hat eine Figur die Einsicht, dass unser Beruf, unsere soziale Position, zufällig sei, Ergebnis, so ließe sich das Zuspitzen, einer gesamtgesellschaftlichen Lotterie. Er, denkt er, könnte auch Schriftsteller werden, das nötige Pathos dazu hätte er, „und Pathos“ sei „ganz eindeutig eine Form von Kriminalität“. Der Dichter als Verbrecher, das ist als Motiv wenigstens so ehrwürdig wie „das kluge Gretel“ und aus dem Munde eines Heiratsschwindlers mit dem Namen Joseph eine gute Pointe.
Der Erzählungsband „Amateure“ vereint Schicksale, die einander für Augenblicke berühren, kollidieren. Dabei lässt Angelika Klüssendorf das schlicht Traurige grotesk und komisch wirken. Oder wie soll man es sonst nennen? Ein Mann will sich umbringen, hat aber noch einiges auf der to-do-Liste des Lebens stehen, sein dilettantischer Banküberfall ist unerwarteterweise erfolgreich, bringt 28 000 Mark, der anschließende Urlaub aber missglückt und auf dem Heimflug, gerade hat er, das „Staubwesen“, begriffen, dass er schwul ist, kommt es zu Turbulenzen. Der Flieger stürzt ab. Wenn wir wissen, wie wir leben sollen, sind wir nicht mehr, meinte Heinrich von Kleist einmal. Solche romantischen Motive, versteckt in gegenwärtigem Alltag, finden sich einige im Werk Angelika Klüssendorfs.
Sie haben in der Öffentlichkeit leider weniger Aufmerksamkeit gefunden als biografische Zufälle – wie der, dass die Autorin in der DDR aufwuchs oder dass sie mit Frank Schirrmacher verheiratet war, dabei hat sie alles literarisch verwandelt. Mich ärgern solche Abwehrgesten gegenüber dem Literarischen.
In „Amateure“ nennt ein West-Mann in den ersten Tagen der Einigkeit, auf einer Fahrradtour Mecklenburg „eine ganz und gar verwunschene Landschaft. Als sei dieser Flecken Erde vor einem halben Jahrhundert jemandem aus der Hand gefallen … und liegen geblieben, einfach so“. Die Edna der Erzählung, die diesem Moritz am 9. November 89 entgegengeklettert war, weiß schon, dass er keine Ahnung hat. Und doch ist mir diese naiv uninformierte Bemerkung auf eine gewisse Weise sympathisch, weil sie entdramatisiert und das Vergangene als Stoff von Erzählungen betrachtet, zugunsten der „gemeinsamen Geschichte“ des Paares.
Angelika Klüssendorf beschreibt DDR-Wirklichkeit genau, so genau wenigstens, dass ich, in Leipzig aufgewachsen, immer wieder bekannte Wohnungen und vertraute Situationen vor mir zu sehen glaube, wenn ich „Das Mädchen“ lese. Die Schilderungen des Kinderheimlebens rufen Pionierlagerszenen herauf, obwohl das nicht zu vergleichen ist. Und im Fall der „Mitropa“, wo Rippchens Mutter arbeitet, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich mich wirklich erinnere oder nur zu erinnern glaube, weil ich Angelika Klüssendorf gelesen habe. Der Sozialismus durchtränkt bei ihr, die wie April Mitte der Achtzigerjahre ausgereist ist, das Leben, haftet ihm an wie ein Geruch, der sich nicht absondern, nicht loswerden lässt. Ich kenne nur wenige Texte, in denen die Alltagserfahrung erdrückender Selbstverständlichkeit so prägnant und beiläufig geschildert wird. Es war schon ein erster Befreiungsschritt, das sozialistische System als „die da“ wahrzunehmen. Nur ein kleiner Teil des Klüssendorfschen Werkes, vielleicht dreißig Prozent, spielt im Arbeiter- und Bauernstaat. Sie hat überwiegend über die Zeit danach geschrieben und über die Erfahrung, dass nach jeder überwundenen Mauer eine weitere sich aufzubauen scheint, vielleicht bemalt, vielleicht aus Glas oder undurchdringlicher Luft, auf jeden Fall beengend, stören. Mit dem Label „DDR-Roman“ ist zu viel Schindluder getrieben worden, zu oft diente es der Exotisierung, als handele es sich um historische Novellen, Fälle für die politische Bildungsarbeit. In diesem Sinne hat Angelika Klüssendorf nicht einen einzigen „DDR-Roman“ geschrieben. Sie erzählt, warum und wie das Kinderheim Modell der Gesamtgesellschaft scheinen kann, dass einmal Eingesperrte dazu neigen, den Moment des Ausbruchs immer wieder herbeizuführen – und dass dies verstörende Energien freisetzt, Lebenshunger, der vor keinem „Giant Burger“ zurückschreckt und auch mit Chirurgen klarkommt.
Diese Erzählerin wird auch den Übeltätern und Scheusalen gerecht, aber nicht nach dem Motto, alles verstehen heiße alles verzeihen. Literatur ist keine Wahrheitskommission, Angelika Klüssendorf erzählt, wie Menschen wirklich agieren, schildert sie in ihrer Zartheit und Bösartigkeit. Ihre Prosa wirft ein helles Licht auf die Art und Weise, in der wir miteinander leben, darauf, was wir einander im Streben nach Glück antun und wie, im Stolpern, Straucheln, Verunglücken das Unwahrscheinliche, Gesellschaft, und das Flüchtige, Glück, entsteht.
Ich gratuliere der Jury zu ihrer Wahl und Angelika Klüssendorf herzlich zum Marie-Luise-Kaschnitz-Preis. Lassen Sie sich feiern, ich bin hungrig nach Ihrem nächsten Buch.
Bild: Jens Bisky während seiner Laudatio (Foto:dgr/eat archiv)