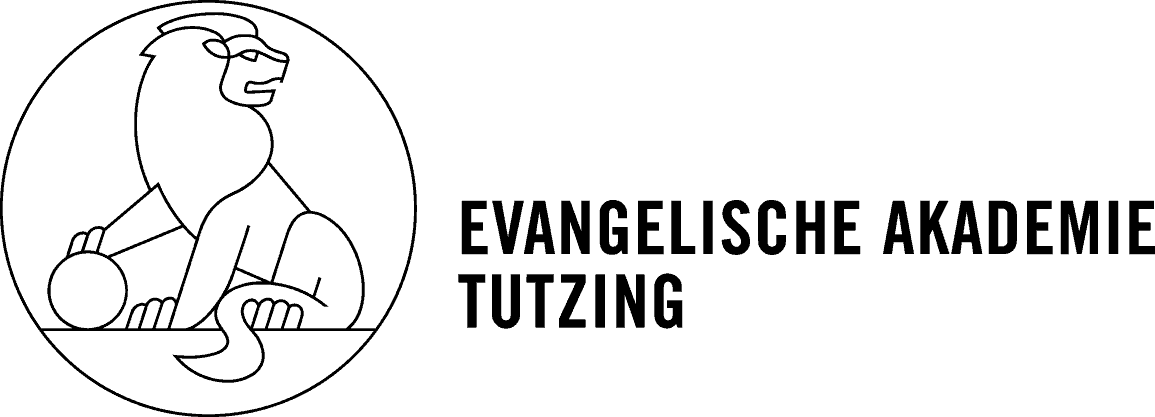Ich habe aufgehört, mich meiner Heimat zu schämen
Ich komme am Ende noch einmal auf meinen Sprung von Hamburg nach Luzern zurück. Ich musste lernen,damit einverstanden zu sein, nicht ganz dazuzugehören. „Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh …“ heißt ein katholisches Kirchenlied. Nein, ich bin nicht Gast „ohne Ruh“ in meiner neuen Schweizer Welt. Ich bin mit Vergnügen Gast in einem schönen Land mit freundlichen Menschen. Aber ich bin Gast. Es ist schön, und es hat etwas mit meiner Freiheit zu tun, dass ich nur ein Halb-Hiesiger bin, kein wirklich Eingewurzelter. Ich spiele mehr zuhause, als ich es bin. Aber es ist ein schönes Spiel. Es ist ein Reichtum, irgendwo feste und lange gewachsene Wurzeln zu haben, Pfahlwurzeln. Es gibt den anderen Reichtum, nicht durch allzu feste Wurzeln gefangen zu sein. Es gibt ja auch Luftwurzeln, die Wasser und Nährstoffe eher aus der leichten Luft als aus festem Grund gewinnen. Aber das ist ja nicht nur meine Lage nach dem Umzug in die Schweiz. Die Wurzeln von uns Alten sind ja überall locker und luftig. Wir sind Gäste einer Welt, die schon lange nicht mehr unsere ist.
Es ist schön, mehrere Heimaten zu haben. Es ist charmant, nicht ganz zuhause zu sein. Wer nur eine Heimat hat, ist in der Gefahr, in ihr zu verdummen. Die Grundtexte des christlichen Glaubens sind nicht sehr heimatfreundlich. Die ersten Nachfolger fragen Jesus nach seinem Ort, seiner Heimat, und er antwortet: „Der Menschensohn hat keine Stelle, wo er sein Haupt hinlegen kann.“ (Matthäus 8,20) Ebenso sehen sich die frühen Christen und Christinnen als vaterlandslose Gesellen: „Unser Bürgerrecht ist im Himmel“ (Philipper 3,20) und „wir haben hier keine bleibende Stadt, denn wir suchen die zukünftige.“ (Hebräer 13. 14) Mit diesen Sätzen in unserem geistlichen Gepäck können wir Heimatlieder kaum aus voller Brust singen. Man wird also nie ganz ein Hiesiger sein, weder in dem Land noch in den Kirchen, in denen wir leben. Das ist eine der Schönheiten des Christentums, dass es uns nicht erlaubt, gebannt zu sein in eine Gegenwart, in der die Lahmen noch nicht tanzen und in der die Tyrannen noch nicht von ihren Thronen gestürzt sind. Aber wir sind nicht nur Zukünftige und Jenseitige, und in reinen Transiträumen kann man nicht leben, lieben, bauen und atmen. Das Recht auf bergende und wärmende Höhlen wird uns niemand absprechen.
Es ist uns nicht versprochen, irgendwo ganz zuhause zu sein. Heimaten sind Rohbau jener Heimat, die wir erwarten. Vielleicht sieht man im Rohbau mehr als im schönen, fertigen und abgeschlossenen Haus. Man sieht im Rohbau, was noch fehlt und was noch nicht da ist. Und so verweist er mich auf das andere Haus – besser: auf das andere Land, in dem alle Verhältnisse umgeworfen sind, „in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“, auf eine Stadt, in der alle Tränen abgewischt sind und „wo der Tod nicht mehr sein wird, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz.“ (Offenbarung 21, 4) Bis dahin sind alle Heimaten mehr Unterstände als wohnliche Orte, wenigstens das sind sie.
Am Ende einige Sätze von Heinrich Böll: „Die Tatsache, dass wir alle eigentlich wissen – auch wenn wir es nicht zugeben -‚ dass wir hier auf der Erde nicht zuhause sind, nicht ganz zuhause sind. Dass wir also noch woanders hingehören und von woanders herkommen. Ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der sich nicht – jedenfalls zeitweise, stundenweise, tageweise oder auch nur augenblicksweise – klar darüber wird, dass er nicht ganz auf diese Erde gehört…. Die Sehnsucht, erkannt zu werden, führt in eine andere Welt.“
Prof. em. Dr. Fulbert Steffensky ist Theologe, Religionspädagoge und Publizist. Er wurde 1933 in Rehlingen im Saargebiet geboren. Von 1969 bis zu ihrem Tod 2003 war er mit der evangelischen Theologin und Dichterin Dorothee Sölle verheiratet. Fulbert Steffensky lebt in Luzern (Schweiz).
Vorliegender Text war Inhalt der Rede Fulbert Steffenskys am 17.11.2018 an der Evangelischen Akademie Tutzing. Die Rechte am Text liegen beim Autor.
Bild: Fulbert Steffensky am 17. November 2018 an der Evangelischen Akademie Tutzing. (Foto: Haist / eat archiv)