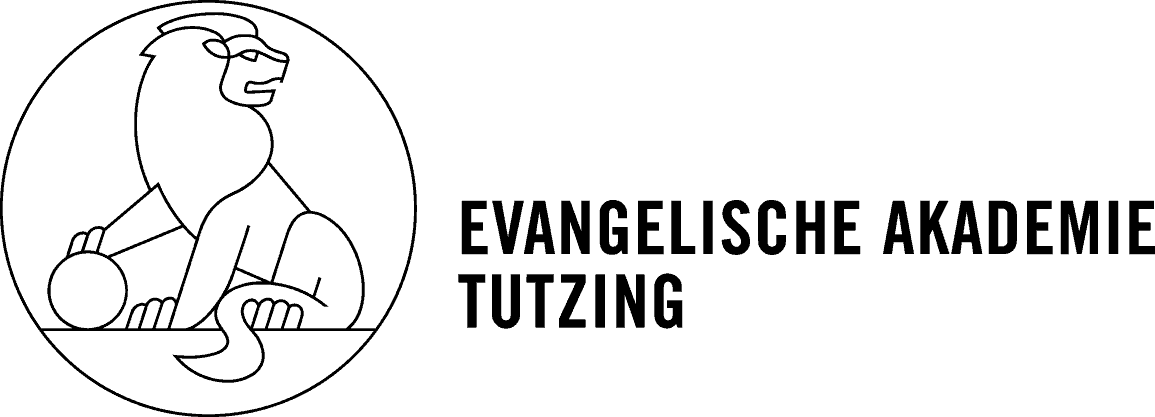Ich habe aufgehört, mich meiner Heimat zu schämen
Ein komisches Exempel für die Nähe zu Dingen mein alter Pullover. Er wärmt mich schon viele Jahre, er ist abgetragen, verwaschen und hat Löcher. Seine Farbe war einmal ein tiefes Braun, jetzt ist er schmutzig-grau. Ich liebe ihn. Meine Frau liebt ihn nicht, darum will sie ihn herzlos zum Abfall geben. Er ist ein Werkzeug, das mich wärmt, aber er ist mehr. Ich bin im Laufe der Jahre, die er bei mir ist, in ihn hineingewachsen. Er ist mir lieb geworden. Ein Teil meines Lebens ist in ihn hineinverwoben. Mit ihm bin ich nicht allein befreundet. Ich könnte eine Reihe von Gegenstände nennen, die jahrelang bei mir sind und die mir viel mehr bedeuten als ihr materieller oder funktionaler Wert: Ein alter Becher, in dem ich meine Stifte aufbewahre, ein Freund hat ihn mir vor 50 Jahren geschenkt; ein alter Hosengürtel, der nicht mehr zu vielem nütze ist und bei mir sein Gnadenbrot bekommt; eine Schere, die schlecht schneidet, die ich aber nicht austauschen will.
Der alte Pullover, der Becher und der Gürtel sind Dinge, die von mir selbst besetzt sind im Laufe der Zeit. „Besetzen“ bedeutet, dass ein Teil meiner Lebensenergie an ihnen haftet. Sie sind mir heimatlich geworden und sie helfen, mir die Welt plausibel zu machen, einfach dadurch, dass sie lange bei mir waren. Heimat besteht nicht nur aus Menschen, mit denen ich umgehe, aus einer Landschaft, die ich kenne und liebe. Sie besteht auch aus Dingen, die Bedeutung für mich haben, weil ich ihnen Bedeutung verliehen habe. Ich zitiere einen Gedanken von Ernst Bloch: In der Heimat ist man nicht nur mit Menschen identisch, auch die Objekte, mit denen man lange umgeht, bleiben einem nicht fremd. Die Dinge rücken uns nahe, fast so nahe wie Subjekte, und die Dinge, die man sich nahe geholt hat, die man ehrt, gehören zur Heimat. Die Objekte können uns so nahe rücken, dass wir darin zuhause sind, jedenfalls ein Stück.
Wo wir die Dinge nicht mehr ehren, mit denen wir umgehen, da entheimaten wir uns selbst. Unsere Überflussgesellschaft ist eine Wegwerfgesellschaft. Wir kaufen und stellen nicht mehr her. Wir kaufen neu und wir reparieren nicht mehr. Natürlich gewinnen wir damit eine neue Freiheit. Wir müssen nicht mehr an langen Abenden Strümpfe oder Pullover stopfen, Kleider reparieren, Ackergeräte ausbessern, Besen neu binden. Wir haben in der neuen Freiheit Zeit für anderes. Ich frage mich aber, ob diese Freiheit nicht erkauft wird mit der neuen Fremdheit in der Welt, in der wir leben. Die Welt wird käuflich, käufliche Welten aber sind keine heimatlichen Welten. Die gekauften Welten tragen die Handschrift unserer Arbeit nicht mehr. Ich möchte nicht zurück in die Knechtschaft der alten harten Welt. Wohl aber möchte ich eine plausible Welt, in der ich die Dinge kenne, weil ich lange mit ihnen umgegangen bin.
Eine Gefahr der Entfremdung des Menschen ist besonders zu erwähnen, es ist die Zerstörung durch Überfluss und Grenzenlosigkeit; eine Bedrohung unserer Heimaten, die die Folge einer grenzenlosen Lebensgier ist. Ich habe das Dorf vor Augen, indem ich selber groß geworden bin. Es hatte vor 70 Jahren etwa 3.000 Einwohner. Diese Zahl ist etwa gleich geblieben, aber die bebaute Fläche des Dorfes ist dreimal so groß. Was bedeutet diese Zersiedlung und Zerstörung des Lebensraumes für die Zukunft unserer Enkel? Vor 70 Jahren gab es kaum ein Auto. Heute kann man sich kaum eine Familie ohne Auto vorstellen. Vor 70 Jahren war meistens nur die Küche geheizt, heute fast jeder Raum des Hauses. Vor 70 Jahren kannte man keinen Urlaub und keine Sommerreisen. Die Gefahren sind nicht mehr zu übersehen: Die Natur lässt nicht mit sich umgehen, wie wir mit ihr umgehen. Sie schlägt zurück. Man muss schon völlig ideologisch verblendet sein, wenn man den Zusammenhang zwischen dem Abschmelzen der Polarkappen, der Versteppung weiter Landschaften, den großen Überschwemmungen der letzten Jahre und unserer Art zu leben leugnen will.
Wir gefährden außerdem die Lebensmöglichkeiten unserer Nachkommen. Mensch ist man dort, wo man sich an seine Vorfahren erinnert und wo man für seine Enkelkinder sorgt. Wo man sich derart über die Kreisläufe der Natur erhebt und ihr Gott und Herr sein will statt ihr Teil, da zerstört man nicht nur sich selber, sondern frisst die Zukunft der eigenen Nachkommen auf. Es gibt Tiere, die ihren eigenen Wurf auffressen, wenn sie nicht ihrer Art entsprechend gehalten werden. Könnte es sein, dass wir ihnen ähnlich werden? Wir können unsere eigene Welten und damit die Welten der zukünftigen Generationen verändern. Wir können ihre natürlichen Ressourcen pflegen oder zerstören. Wir können mit den ungeheuren technischen Möglichkeiten ihr Klima verändern. Wir können die Länder versteppen. Wir sind die Züchter der Welten unserer Nachkommen geworden. Zur Heimat gehört, für die Heimat zukünftiger Generationen zu sorgen, für die Welt unserer eigenen Kinder und Enkel. Und so ergibt sich ein neuer Imperativ des Handelns: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“ (Hans Jonas)
Zur Heimat gehört, für die Heimat zukünftiger Generationen zu sorgen. Wir selber werden unserer eigenen Welt entfremdet, wenn wir uns als ihr gottgleicher Herr aufspielen. In dem Dorf meiner Heimat, das ich erwähnt habe, verschwinden seine alten Eigentümlichkeiten. Der Dialekt verschwindet mehr und mehr. Man spricht dort, wie man überall spricht. Die Eigentümlichkeiten des Verhaltens verblassen. Die Erzählungen und die Erinnerungen verblassen. Die eigentümliche Küche verschwindet. Wenn man im Nu überall sein kann und überall ist, wenn man im Nu alles Verfügbare haben kann, dann verschwindet die Eigentümlichkeit der Welt. Es entstehen gleichförmige Welten, MacDonald‘s-Welten, in denen Menschen überall das gleiche essen, denken, lieben, sich auf gleiche Weise innerlich und äußerlich ausstatten. Menschen entheimaten sich, sie werden ubiquitär und allgegenwärtig. Damit aber verlieren sie ihr Hier und Jetzt, ihren Ort und ihre Erlebniszeit. Die neue Blitzartigkeit und Verfügungsgewalt bedeutet den Verlust des irdischen Raums, eben der Heimat. Die irdischen Räume werden zerstört. Alles wird gleich, alles wird gleichgültig. Wer aber sind wir, wenn wir alle Erdenschwere verloren haben? Wo gehören wir hin? Was lieben wir und wem sind wir verpflichtet?
Wir können nicht zurückwollen in jene alte und harte Zeit, in der die Menschen Sklaven einer kalten Natur waren, in der sie die Natur nachgeahmt haben und auch gegeneinander hart waren. Wir können uns aber auch nicht weiter wie bisher als die Götter und die Moloche dieser Erde aufspielen. Vielleicht müssen wir einem alten Wort neue Ehre geben, dem Wort Askese: Askese oder Bescheidenheit als politische Tugenden. Es ist hier nicht eine Opferaskese gemeint, die dem Menschen befiehlt, das Beste von seinem Leben einem hungrigen Gott zu geben. Mit dem Begriff Askese war immer der Gedanke der Freiheit verbunden. Der freiwillige Verzicht sollte die Menschen davor bewahren, Sklave der Welt zu werden: Sklave des Geldes, des Essens und Trinkens, seiner Sexualität. Zugegeben, das alte asketische Denken war prinzipiell misstrauisch gegen die Freude am Leben. Es gibt aber eine Askese, die der Freiheit und der Lust am Leben dient. Diese Askese lehrt uns, neue Fragen zu stellen: Welchen Ort muss ich nicht sehen, damit ich andere Orte mit offenen Augen sehen kann? Welches Buch muss ich nicht lesen, damit ich andere Bücher mit wachem Geist lesen kann? Was muss ich nicht haben, damit meine Lust an den Dingen wächst, die ich habe? Welchen Lebenskuchen muss ich nicht essen, damit meine Lust am Lebensbrot wächst. „Überflüssige Dinge machen das Leben überflüssig.“, sagt Pasolini. Wir brauchen eine Askese, die die Sinnenhaftigkeit des Lebens erhöht. Man kann Askese und Sinnlichkeit zusammendenken. Sinn und Sinnlichkeit hängen nicht nur im Wortstamm zusammen. Es gibt keinen Lebenssinn ohne die Erfahrung der Sinnlichkeit des Lebens.