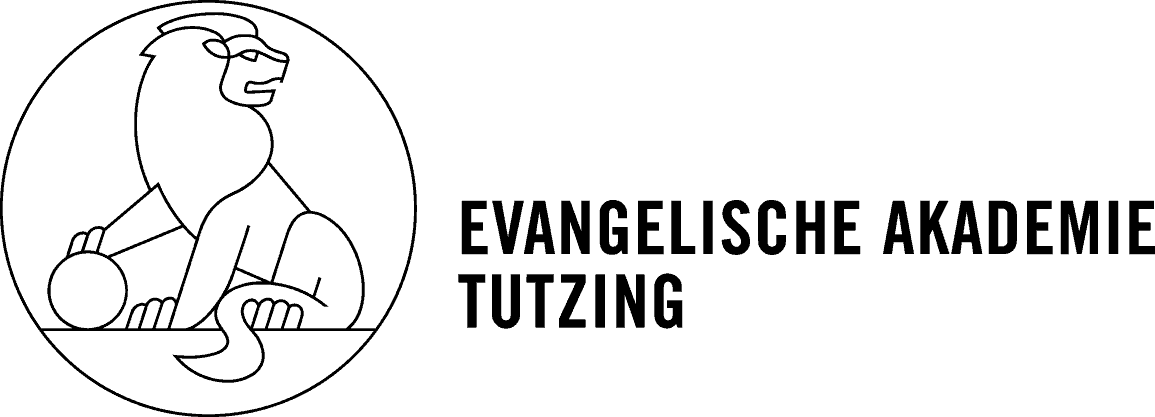Ich habe aufgehört, mich meiner Heimat zu schämen
Zurück zu meiner eigenen Geschichte, zu meiner wohl letzten irdischen Heimat: Luzern! In meinem Alter – ich bin 85 – haben Anfänge meistens den Geruch des Endes. Man fängt an, die Wohnung aufzulösen und zieht ins Altersheim. Man fängt an, Dauergast bei Ärzten oder im Krankenhaus zu werden. Man fängt an, sich daran zu gewöhnen, dass es keine Anfänge mehr gibt. Es sind also Anfänge, die aus Beendigungen geboren sind, aus Abschieden und Verlusten.
Nun habe ich vor einigen Jahren einen Anfang gewagt, der eigentlich ungehörig ist. Ich bin von Hamburg in die Schweiz gezogen, nicht um meine alten Knochen im Tessin zu wärmen, sondern weil ich die Zuneigung eines Menschen gefunden und wieder geheiratet habe. Geht das? Was habe ich gewonnen, was habe ich verloren?
Zunächst habe ich die Liebe eines Menschen gewonnen und bin der Einsamkeit nach dem Tod meiner Frau entronnen. Ich weiß wieder, wohin ich gehöre. Ich weiß, dass jemand wartet, wenn ich verreise. Ich teile mit einem Menschen das Brot und die kleinen und großen Dinge des Alltags. Das Wichtigste, was einem Menschen geschenkt werden kann, ist mir zugefallen.
Es gibt nichts ohne Preis: Ich habe meine alte Welt verloren – nicht völlig, denn die eintausend Kilometer zwischen Luzern und Hamburg sind in acht Stunden zu überwinden. Aber die alte Welt ist nicht mehr Alltag, sie ist von Zeit zu Zeit ein Geschenk. Dann bin ich wieder bei meinen Kindern und Enkeln, dann wohne ich unserem alten Haus, dann sind die alten Freundinnen und Freunde wieder da, dann bin ich wieder am Grab meiner Frau. Welten bestehen nicht nur aus Menschen. Sie bestehen auch aus Orten, Dingen und Vorgängen, die einen beheimaten. In Hamburg hat mich auch das Tuten der Schiffe im Novembernebel beheimatet. Ich war heimisch in der Stadt, weil ich wusste, wie die S-Bahn verlief und wie ich am besten von Altona nach Wellingsbüttel kam. Die Orte kannten und grüßten mich: meine alte Universität, die Katharinenkirche, die Eckkneipe mit dem schönen Namen „Alles wird gut“, das KZ Neuengamme. Dinge und Orte können einem nicht nahe sein wie Menschen. Aber sehr nahe können sie einem schon sein. Es gibt übrigens Schönheiten, die man erst entdeckt, wenn man nicht durch die Nähe zu ihnen geblendet ist. Die Schönheit eines weiten und durch keinen Berg verstellten Blick in einer norddeutschen Landschaft habe ich erst im Land der Berge entdeckt. Wenn ich meine Schweizer Frau ärgern will, sage ich: Ihr habt Berge, wir aber haben Horizonte. Die größere Distanz der Hamburger zueinander habe ich erst schätzen gelernt, als ich in Luzern erfuhr, wie oft man sich umarmt, küsst und wie schnell man sich duzt. Ich habe kein Heimweh nach der verlorenen Welt. Dazu habe ich schon zu viele Abschiede hinter mir. Wohl aber denke ich mit Wehmut an sie und will sie nie ganz verlieren. Ein Glück: Ich muss sie nicht völlig verlieren.
Nun also lebe ich in Luzern. Ich habe einen Menschen gewonnen, nicht aber eine Welt. Welten können Menschen nie ersetzen. Aber Menschen können auch Welten nicht ersetzen. Ich lebe in der Schweiz im Glück einer neuen Zuneigung und als freundlich geduldeter Fremdling. Auf meinem neuen Pass steht: „Ausländerausweis. Aufenthaltsbewilligung, gültig für die ganze Schweiz“. Merkwürdigerweise hat man mir, dem damals 77-jährigen Spätankömmling, auch eine Arbeitsbewilligung gegeben. Die Bezeichnung des Ausweises finde ich genau und passend. Ich bin in dieser Welt nicht zuhause, ich bin ein freundlich aufgenommener Gast. Es stimmt nicht ganz, denn ich fange an, hier in der Innerschweiz meine Welt zu entdecken. Schon kenne ich meine Lieblingsberge, zu denen es mich hinzieht. Ich kenne die beste Badestelle im Luzerner See. Ich weiß, wohin ich in die Gottesdienste gehe und welche ich am besten meide. Es gibt ein paar Menschen, die ich noch nicht Freunde nenne, mit denen ich aber freundschaftlich umgehe. Die Welt wächst. Sie wird nicht mehr werden, wie es die Hamburger Welt war. Welten wachsen in Jahren, und Jahre stehen mir nicht mehr zur Verfügung.
Was brauche ich in der neuen Gastwelt, damit ich nicht völlig ein Fremdling mit Arbeitserlaubnis bleibe? Zunächst eine gewisse Treuelosigkeit der alten Welt gegenüber. Ich werde nie Boden unter die Füße bekommen, wenn ich ständig der alten Welt nachweine. „Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist.“ (Philipper 3, 13) Nein, ich vergesse die alte Welt nicht. Aber sie hat kein Recht, das Diktat meiner Erinnerung zu sein. Sie hat kein Recht, sich als einzigartig aufzuspielen. Die verklärte Erinnerung an die alte Welt könnte sich als Feind der neuen erweisen. Das „Früher war alles besser“ liegt uns Alten sowieso gefährlich nahe. Eine Weise, gänzlich unbeheimatet im Neuen zu bleiben, ist der Vergleich der beiden Welten, der alten und der neuen. Vergleiche sind immer bösartig und zerstörerisch, nicht nur in diesem Fall.
Neugier brauche ich auf die neue Welt. Neugier ist auch Arbeit, sie fällt einem nicht einfach in den Schoß, besonders uns Alten nicht, die sich so gern in der Erinnerung ergehen und denen das Neue eher unheimlich ist. Man muss den neuen Welten zutrauen, dass es in ihnen etwas zu entdecken gibt, was man vorher nicht kannte und was seine eigene Schönheit hat. Meine Neugier bezieht sich nicht nur auf Landschaft und Menschen mit ihren Eigenarten, die ich noch nicht kannte. Neugierig bin ich auf die Sprache, die um mich gesprochen wird. Ich bin entzückt, wenn ich auf einem Rasen ein Schild entdecke, das ein „Versäuberungsverbot“ ausspricht oder wenn in einer Metzgerei „Schweinsvoressen“ angeboten wird. Ich bin in der Schweiz ja auch Sprachausländer. Den Menschen um mich ist mein Hochdeutsch eine Fremdsprache. Sie sprechen es, aber mit schwererer Zunge, als ich es spreche. Auch diese Tatsache lässt eine Distanz zu den Menschen, mit denen ich umgehe, eine freundliche Distanz. Distanzen müssen ja nicht immer feindlich sein. Aber mit meiner anderen Sprache und der Unfähigkeit, die hiesige zu sprechen, weiß ich, dass ich nie ganz dazugehöre.
Vertrautheit mit einem Ort braucht Zeit, wie Heimat nie „instant“ zu haben ist. Heimat ist eine Geliebte, die einem als Erstes Zeit abverlangt. Wo man Zeit investiert, da ist man schon halb zuhause, auch wenn man nicht dort wohnt. Ich kenne und liebe schon lange eine kleine romanische Kirche in Giornico im Tessin. Ich besuche sie, sooft ich in der Gegend bin, und da ich in Luzern wohne, bin ich oft da. Die Kirche ist mir vertraut. Sie ist mein Gehaichnis und die Gebete in ihr fließen einem von selbst über die Lippen. Nun gut, meine Heimat ist sie nicht. Und trotzdem ist es ein Nachhausekommen, wenn ich dort bin. Sie ist wie eine heimliche Geliebte, die immer schöner wird, um so öfter ich sie besuche. Ich lebe nicht nur von meiner sozusagen standesamtlichen Heimat. Ich lebe auch von solchen Stellen, die ich gefunden habe, die ich achte, indem ich sie besuche und die ich schön finde, weil ich sie nicht vergesse. Vielleicht sind sie nicht lebensnotwendig, aber sie sind schön, und Schönheit ist immer lebensnotwendig. Sehnsuchtsorte, Orte mit Gehaichnis, Heimaten muss man immer wieder neu erfinden.
Heim und Heimat gehören zusammen, und manchmal konnte Heim für Heimat stehen, so in dem „Geistlichen Blumengärtlein“ von Gerhard Tersteegen: „Mein Heim ist nicht von dieser Zeit.“ dichtet er. Heimat ist der Ort, an dem man wohnen kann. Dort hat man Wohnrechte, dies nicht nur im äußeren und formalen Sinn. Heimat ist der heimelige Ort, an dem das Leben warm und aufgehoben ist, der Ort, an dem das Leben einleuchtet. Die Arbeit an den Dingen ist die Weise, sich im Leben zu beheimaten. In alten und kargen Heimaten blieb den Menschen nichts anderes übrig als die Dinge zu erarbeiten. Die alten Heimaten trugen immer die Handschrift der Menschen, die darin lebten. Ich denke an meine Kindheit und an das Verhältnis zu den Dingen, das Menschen hatten. Man hat wenig gekauft, man hat erarbeitet. Die Menschen hatten Künste, die wir lange vergessen haben. Sie wussten, wie man Würste macht, Sauerkraut einlegt, Schinken räuchert. Sie wussten, wie man sät und erntet. Man ging selten zum Arzt, man kannte Heilkräuter. Die Frauen wussten wie man Kinder gebiert und wie man Tote wäscht. Die Männer wussten, wie man Korn mäht und Sensen dengelt. Es gab kaum Abfall, weil man nichts weggeworfen hat. Man hat nicht neu gekauft, sondern repariert, geflickt und gestopft. Die Menschen kannten jede Biegung der Wege, weil sie die Strecken nicht in hoher Geschwindigkeit durchfuhren, sondern zu Fuß gingen. Ich wünsche mir die Mühsal jener Zeit nicht zurück, sie hat die Menschen zu sehr gequält. Trotzdem, die Dinge waren ihnen nahe, beinahe wie Menschen, weil sie daran gearbeitet hatten.