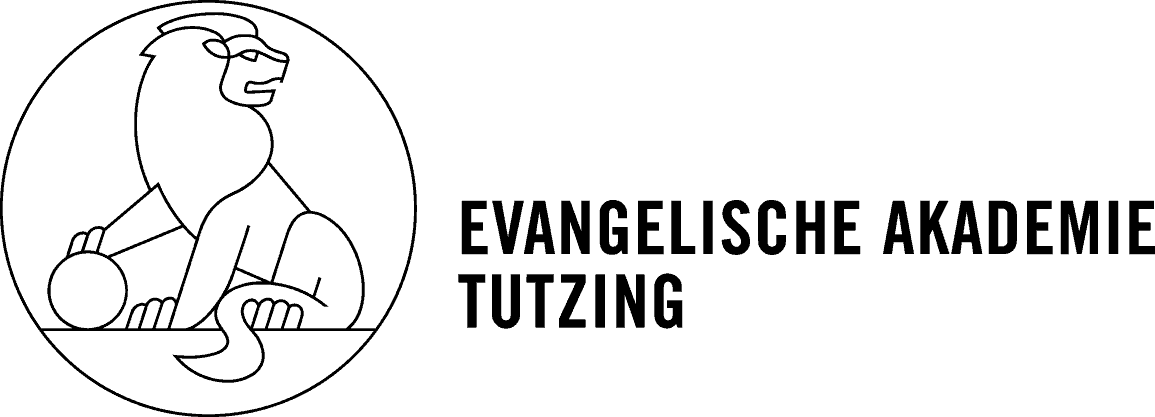Ich habe aufgehört, mich meiner Heimat zu schämen
Rede des Theologen Fulbert Steffensky auf der Herbsttagung des Politischen Clubs 2018 zum Thema „Streit um Heimat“.
Das Wort Heimat gehörte kaum zu meinen Sprachschatz; wenn, dann nur gebrochen und mit Deutungszusätzen, die die Minen entschärfen sollen, die in ihm liegen. Ich verstehe die Philosophin Carolin Emcke, die schreibt: „Ich habe nie die deutsche Nationalhymne gesungen, … habe nie die deutsche Fahne geschwenkt, … Ich weiß um die Unbelastetheit der Strophe und ihrer Aussage ebenso wie um die Fahne und ihre Farbe – und dennoch bereitet es mir Unwohlsein. Ebenso wie alle Begriffe wie ‚Heimat‘, ‚Vaterland‘, ‚Patriotismus‘, ‚Stolz auf Deutschland‘, all das, woran ich in den letzten Jahren immer stärker gemahnt werde, dass ich es empfinden sollte.“
Am Abend der Hessenwahl vor einigen Wochen hörte man beim Bericht über die AfD im Hintergrund die Nationalhymne, gesungen von den siegberauschten AfDlern. Das hat mir diese Hymne wieder verleidet. Wörter sind nicht unabhängig von den Orten und Personen, von denen sie benutzt werden. Es gibt keine ungeschändete Sprache, auch das Wort Heimat hat seine Blutflecken, spätestens seit der Nazizeit. Dem Problem kann man nicht entgehen, indem man die Wörter verschweigt. Wir müssen sie reinigen.
Was also kann Heimat bedeuten, wenn das Wort niemanden mehr bedroht und gegen niemanden gewendet ist? Ich will mich dem Begriff Heimat nähern, indem ich beschreibe, welche Heimaten ich durchlaufen habe. Ich habe eine alte Frau, im Saarland geboren und immer dort geblieben, gefragt, was für sie Heimat bedeutet. „Heimat“ hat sie in ihrem schweren moselfränkischen Dialekt geantwortet: „Heimat is do, wo ich Gehaichnis han.“ – Gehaichnis, ein schwer zu entzifferndes Wort, das man nur im Hunsrück und im Saarland findet. Es bedeutet Wärme, Geborgenheit, Vertrautheit und Vertrauen, Sich-Auskennen, nicht in Frage stehen.
Ich gehe von diesem Wort aus und frage, wo ich mein Gehaichnis hatte oder habe und welche Gesichtszüge meine Heimaten trugen. Meine erste Heimat, das Land meiner Geburt, das Saarland. Lange hat man unter Heimat den Geburtsort verstanden. „Mein Heim ist immer da, wo meine Wiege stand“ heißt es in einem saarländischen Heimatlied. Heute sind die meisten in unserer Gesellschaft Zugvögel, und sie leben schon lange nicht mehr, wo sie geboren sind. Dieser Geburtsort war nur beschränkt Heimat, weil ich sie nicht gewählt hatte. Ohne mein Zutun war sie eine verordnete Heimat, ob sie gut war oder schlecht. Zuhause ist man dort, wo man sein Zuhause wählen kann. Darum sind alle Geburtsheimaten vorläufige und überholbare Heimaten, denen immer etwas fehlt: Man hat sie nicht gewählt, sie sind Verhängnis, nicht immer im fatalen Sinn, aber oft. Fatal sind sie vor allem, wo es verboten ist, ihnen zu kündigen.
Zum Gehaichnis, zum Zutrauen in die Heimat gehört, dass man in ihr anders als alle anderen sein darf; dass dort Fremdheit und Fremde geduldet sind. In dieser saarländischen Heimat war keine Fremdheit vorgesehen. Man war einmalig und kannte keine Fremden. Es gab keine Ausländer, fast alle waren katholisch, man kannte keine andere Religion als das Christentum. Man kannte keine andere Form der Sexualität als die offiziell gebilligte, keine andere Form der Kindererziehung als die übliche und keine andere Weise des Kochens als die immer schon gewohnte. Es lebte sich gut in diesem Dorf, wenn man dazugehörte und wenn man eingebürgert war in den allgemeinen Glauben und die allgemeine Lebenspraxis. In dieser Heimat stand man unter dem Diktat, zu sein wie alle anderen. Das hat viele junge Menschen gequält und sie haben die Heimat im Zorn verlassen. Es war ein einstimmiges Dorf, aber dies war sein Problem. Man weiß nur, wer man ist, wenn man sich dem Schmerz der Fremdheit aussetzt. Man lernt den eigenen Reichtum erst kennen, wo man sich mit fremden Lebensentwürfen und fremder Religion auseinandersetzen muss. Man lernt den eigenen Mangel erst kennen, wenn man auf den Reichtum der Fremden stößt. Wo man nur sich selbst kennt, besteht die Gefahr, dass man sich für einzigartig hält. Man kann sich kaum hinterfragen, wo man die Fremden und das Fremde nicht an sich heranlässt. Man bringt sich um die Freiheit, zu wachsen und mehr zu werden, als man ist, wo man sich der Fremdheit der anderen verweigert. Zuhause ist man, wo man anderen Häusern begegnet und sie duldet. Eine fremdenfeindliche Heimat ist auch für die Einheimischen keine Heimat. Diese erste Heimat habe ich verlassen, sie berührt mich kaum noch. Ich möchte keine Heimat, in der Menschen nur mit sich selbst identisch sind.
Es kamen noch einige Heimaten, ein Kloster, in dem ich einige Jahre war, Köln, Hamburg, Luzern, wo ich heute lebe. Alle diese Heimaten hatten einen Vorteil: Ich habe sie gewählt und darum war ich in ihnen mehr zuhause. Die längste Zeit meines Lebens habe ich in Hamburg gelebt. Dieses große Hamburg lässt mir die Wahl. Ich muss nicht überall und im gesamten Hamburger Geist beheimatet sein. Ich kann einige Orte in Hamburg lieben und andere links liegen lassen. Ich kann die Szene lieben und die Hochkultur links liegen lassen (oder umgekehrt). Es zwingt mich keiner, richtiger Hamburger zu sein. Die große Stadt lässt mir Distanz: Distanz und Einsamkeit. In meinem Geburtsort ist bis heute Distanz nicht vorgesehen – und keine Einsamkeit. „Sei einer von uns!“ ist das große Diktat. Aufgehoben aber kann man nur dort sein, wo man nicht gefesselt ist. Aufgehoben kann man nur dort sein, wo man einer Lebensweise oder einem Ort auch kündigen kann. Ich bleibe ein freier Mensch.
Aber, so frage ich mich selbst, kann man dort zuhause sein, wo jedem gleichgültig ist, was ich tue oder lasse? Meine Geburtsheimat hat mich drangsaliert, aber sie hat mich auch aufgenommen, weil sie mich verpflichtet hat. Kann es ein eigener Ort werden, wenn der Ort mich in keiner Weise bindet und wenn ich mich selbst an den Ort nicht binde? Auch die Heimat kann zur Einöde werden, die mir nichts abverlangt und die mich nicht aus meiner gloriosen Selbstverfangenheit befreit. Heimat kann nur sein, wo ich verpflichtet werde. Pflicht ist ein ungeliebtes und ein unaufgebbares Wort. Beheimatet kann ich nur sein, wo ich mich kümmere. Auch das gehört zu meiner Heimatwahl, dass mir nicht gleichgültig ist, was in ihr geschieht. Wie werden die Verkäuferinnen in den großen Einkaufsketten bezahlt? Wo zerstört die Gentrifizierung von Stadtteilen die Lebensqualität? Wie werden die Flüchtlinge behandelt? Was ist das Hauptinteresse meiner Kirche? Wie gelingen oder verkommen unsere Schulen? Sich um diese Fragen zu kümmern, macht den Ort wirtlich und bindet mich an ihn. Es gibt keine Heimatliebe ohne Sorge für diese Heimat. Der bloße Zuschauer sieht nichts, er ist nirgends zuhause, er bleibt Fremder.
Die andere Frage der Beheimatung heißt: Was geschah in dieser Stadt, was geschah in meiner Heimat? Ich habe vor mir ein Heimatbuch liegen, das die Geschichte eines Dorfes schildert. Es wird von der Entstehung des Kirchengebäudes erzählt, die alten Schulen werden beschrieben. Aber es wird eine Freiheitsgeschichte nicht erzählt, wie nämlich Frauen bei einem Streik in den Kohlengruben in jener Gegend einmal die Streikbrecher vertrieben haben. Es wird nicht erzählt, dass in den letzten Tagen des Krieges am Rande des Dorfes fünf russische Gefangene aufgehängt wurden. Also es wird nicht erzählt, was das Herz jeder Erzählung ausmacht: die Erinnerung an die Toten, das Gedächtnis ihres Lebensgelingens und ihrer Leiden. Die Geschlechternamen zu wissen, über die Entstehung von Schule und Kirche Bescheid zu wissen, ist eine schöne Erinnerung. Aber sie wird zu einer geschönten Erinnerung, wenn alle gefährlichen Erinnerungen ausgeblendet werden. Die nur schöne Erinnerung ist schön, aber sie hat weiter keinen Appell und keinen Trost. Wir können schwer leben, wenn wir nur Heutige sind und wenn wir keinen anderen Raum als den hiesigen haben. Heimat ist der Ort, an dem man weiß, was die Toten dieses Ortes geträumt und gelitten haben. So gehört zu meiner Hamburger Heimat die Erinnerung an das Konzentrationslager Neuengamme. Zigtausende wurden dort gefoltert und durch Schwerstarbeit in den Tod getrieben. Heimat ist dort, wo man sich der Namen der Toten erinnert, der Ort, wo man sich schämen und wo man bereuen darf, ohne vernichtet zu werden.
Wir, die Gegenwärtigen, sind in unseren Heimaten nicht nur, die wir sind. Wir sind auch unsere Herkunft und wir tragen die Brandspuren des Gelingens und des Misslingens, der Schuld und des Leidens unserer Väter und Mütter. Nein, wir sind an unserer Vergangenheit nicht schuldig im direkten und personalen Sinn. Ich bin es nicht, der in jener tödlichen Zeit noch ein Kind war. Viel weniger sind es meine Kinder und Enkelkinder, für die jene Zeit schwarze Vorzeit ist. Aber man lernt, wer man ist, wenn man weiss, woher man kommt. Wir sind nicht schuldig an jenen dunklen Jahren, aber wir sind verwickelt in sie. Es waren unsere Väter und Mütter, meine Lehrerinnen und Pfarrer, meine Dichter und Philosophen, meine Musikerinnen und Maler, die in jener Zeit geschwiegen haben, die benutzt wurden und die sich haben benutzen lassen. Die mir das Leben geschenkt haben, haben es anderen genommen oder leidenschaftslos zugesehen, wie es anderen genommen wurde. So gehöre ich hinein in die Geschichte der Verstrickung. Bei Christina von Braun lese ich: „Man kann nicht Goethe und die deutsche Musik, der alle Völker des Abendlandes verzückt lauschen, annehmen, aber diesen Teil des deutschen Erbes ausschlagen. Erbschaften sind unteilbar.“ (Stille Post. Eine Familiengeschichte, 2008, 184)
Man darf sich seine Herkunft nicht rauben lassen, auch nicht die Herkunft aus Korruption und Verbrechen. Ich habe keine Option, Deutscher zu sein oder nicht. Ich bin Deutscher. Ich identifiziere mich mit diesem Land, das heißt Verantwortung zu übernehmen für seine Vergangenheit und Gegenwart. Es gehört zu meinem Stolz, diese Zugehörigkeit nicht zu leugnen. Ich habe aufgehört, mich meiner Herkunft zu schämen, ich habe es lange getan. Ich habe oft, wenn ich im Ausland war, zu verbergen versucht, dass ich deutsch bin. Eine alte Jüdin, die den Schrecken der Pogromnacht 1938 in Hamburg erlebt hat, sagte: „In jener Nacht ist mir die Heimat zum Feindesland geworden.“ Und nun umgekehrt: Die Erinnerung macht mir das Land mit seinem schweren Schatten zum Heimatland, und es wird wieder zu „einem bewohnbaren Land mit einer bewohnbaren Sprache“, wie Heinrich Böll dies nennt. Die Erinnerung an die Opfer und an die Schuld des Landes macht es gerade nicht zu einem furchtbaren Land. Im Gegenteil: Man kann nicht atmen an den Orten, an denen das Gedächtnis und die Erinnerung an die Opfer verboten ist. Wehe einem Volk, das die Erinnerung an die eigenen Vergehen vergisst oder verschweigt oder das das Denkmal an die eigene Schande als Schande empfindet. Heimat ist der Ort, an dem man die Zusammenhänge durchschaut. Heimat ist der Ort, an dem man etwas über die Toten zu sagen weiß. Wir machen uns kenntlich und entkommen aus der Gefangenschaft unserer eigenen engen Individualität, indem wir unsere Herkunft nicht verschweigen. Ich will wissen, wer ich bin, dies aber erfahre ich, indem ich lerne, woher ich komme. Heimat ist der Ort, an dem die Toten ihre Namen haben, also nicht einfach der Ort ungetrübter Harmonie. Die Planierung unseres Gedächtnisses entheimatet uns ebenso sehr, wie die Planierung unserer Landschaften, die wir beklagen. Heimat erkennt man an den Narben, die sie trägt, die Narben der Folter und die Narben der Schuld. Odysseus, der Held der griechischen Mythologie, kehrt nach langer Abwesenheit in seine Heimat zurück, und ist in seiner äußeren Erscheinung unkenntlich geworden, und so muss er seinen Vertrauten seine Identität ausweisen. Das Identitätsmerkmal ist die Narbe einer alten Wunde, die er ihnen zeigt. Auffällige Narben werden manchmal heute noch als unveränderliche Kennzeichen in den Pass eingetragen. Odysseus zeigt die Spuren seiner alten Wunde, also das, was einmal seine Identität aufs Äußerste bedroht hatte, wird in der Narbe, in der Erinnerung an die Wunde, zum Kennzeichen der eigenen Person. Unsere unveränderlichen Merkmale sind Narben der Schuld. Sie weisen uns aus, auch wenn sie unsichtbar sind. Sie schmerzen gelegentlich, aber nicht immer, und wir bestehen nicht nur aus unseren Narben. Und niemand hat das Recht, sie ständig aufzureißen und sie neu zu Wunden zu machen. Die Toten haben das Recht, dass ihre Namen und ihr Schicksal genannt werden. Sie haben kein Recht, den Lebenden die Sonne zu nehmen und sie aus ihren Gräbern heraus zu beherrschen. Die Erinnerung ist nicht unser großes Gefängnis, sie ist unsere Freiheit.