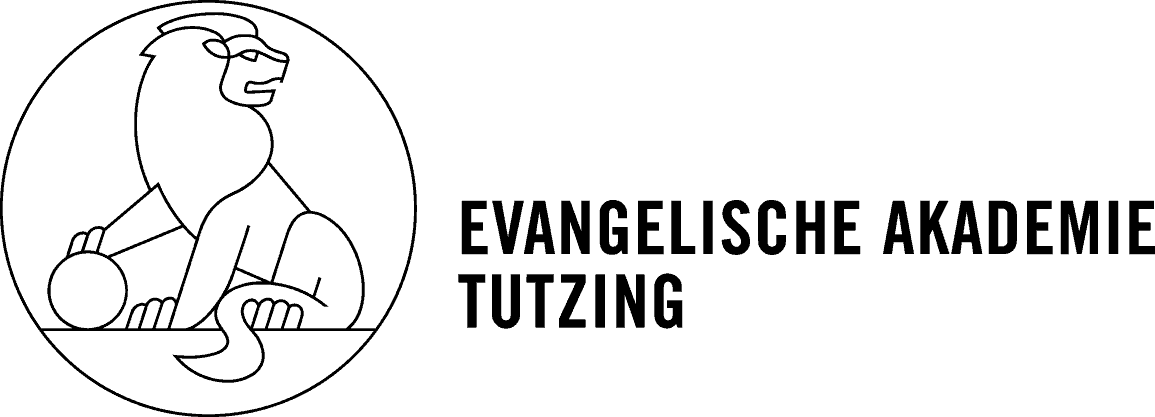Für eine sorgende Hospizgesellschaft
Der Umgang mit Sterbenden zeigt, in welcher Gesellschaft wir leben – und für welche wir uns einsetzen wollen. „Gastfreundschaftlichkeit für alle, die es brauchen“, ist die Idee des hospizlich-palliativen Gesellschaftsmodells. Hospizliche Haltungen sind darüber hinaus für das Zusammenleben wertvoll, findet Andreas Heller von der Universität in Graz. In diesem Blogbeitrag erklärt er, warum.
Von Andreas Heller
Das Sterben wird uns alle betreffen, eines Tages, irgendwann. Nicht, dass wir sterben, sondern wie wir sterben wollen und können, wird heute leidenschaftlich diskutiert. Sterben ist eine soziale Erfahrung. Es beginnt hier und heute mit dem Sterben und dem Tod der anderen. Wir sind Menschen in Beziehungen, bis zum letzten Atemzug. Im Umgang mit dem Sterben und den Sterbenden können wir auch wie unter einem Vergrößerungsglas erkennen, in welcher Gesellschaft wir leben und für welche Gesellschaft wir uns jetzt einsetzen wollen. Das “hospizlich-palliative Gesellschaftsmodell” lebt bis heute von der Idee der Gastfreundschaftlichkeit für alle, die es brauchen. Und wir brauchen es, gebraucht zu werden. Wir stehen an einer Wegscheide. Wohin wollen wir gehen? In eine solidarische, sorgende Hospizgesellschaft? Eine hospizliche Orientierung wäre eine wichtige Perspektive für die Zukunft unserer Gesellschaft. Hospizliche Haltungen sind elementarer denn je für unser Zusammenleben: zuwenden statt abwenden. Zuhören statt weghören. Dableiben statt weggehen.
Hospizlich-palliative Arbeit ist in der Breite unserer Gesellschaft hochgradig und parteiübergreifend anerkannt. Hospize sind seit 40 Jahren kleine Kontrastgesellschaften. Der Idee der Gastfreundschaftlichkeit verpflichtet, der Akzeptanz der anderen um ihrer selbst willen. Es waren empathische Frauen und Männer, die sich nicht damit abfinden wollten, dass Menschen als “austherapiert” galten, zum Sterben abgeschoben wurden in Badezimmer und in Abstellräume der Krankenhäuser und Pflegeheime. Ihr Ziel war die Resozialisierung der Sterbenden in die sozialen und wärmenden Beziehungen menschlichen Miteinanders, einer absichtslosen Sorge.
Wir werden uns fragen müssen: In welcher Gesellschaft wollen wir selber leben und sterben? Wird es eine technoide Suizidassistenzgesellschaft sein? Assistenz haben wir eigentlich genug. Ob krank oder gesund. Wir gehen immer auf den Krücken der Dienstleistungsgesellschaft. Für alles greifen wir auf Service, auf Geräte, auf Gekauftes zurück. Von der Wiege bis zu Bahre. Ist nicht um die Geburt ein hochtechnisierter Apparat entstanden, der Mutter und Kind kaum noch aus der passiven Lage herauskommen lässt? Am Ende des Lebens ist es nicht anders. Der Geburtskanal, der ins Leben führt und der Sterbeweg, der aus dem Leben führt, ähneln sich immer mehr – beide sind in die Hände assistierender Profis geraten. Wir können aber auch auf den großen Schatz hospizlichen Erfahrungswissens zurückgreifen. Den haben viele Engagierte, nicht zuletzt Ehrenamtliche in den letzten Jahrzehnten gesammelt. Gut, die Hospizbewegung muss vielleicht jünger und flexibler werden. Und ja, die Hospizbewegung muss sich aus der bürgerlichen Engführung befreien.
Die Krisen unserer Gesellschaft erfordern Mitmenschen, die begriffen haben, dass wir nicht tiefer in die eisigen Gewässer der Dienstleistungsgesellschaft geraten dürfen. Die technoiden Phantasien, nach denen sich das Leben mit Technik, Planung und Management bewältigen ließe, geraten selbst in die Krise. Was wir brauchen ist eine neue Dynamisierung der Hospizbewegung, die sich in die Tiefen dieser Gesellschaft verbreitet und ihre Vielfalt und Buntheit widerspiegelt.
Was wir brauchen, ist die Mitarbeit an einer sorgenden Gesellschaft (caring communities), in der das Schicksal der anderen nicht gleichgültig lässt, in der das Leben eine Aufforderung für alle ist, es mitverantwortlich zu schützen. Die Krisen unserer Zeit: Corona, Krieg, Klimakatastrophe sind ungleiche Geschwister. Sie könnten den Boden bereiten für eine Gesellschaft solidarischen Aufbruchs, für eine sorgende Hospizgesellschaft.
Zum Autor:
Prof. Dr. Andreas Heller, M.A., ist katholischer Theologe und Pflegewissenschaftler. 2007 wurde er auf den ersten europäischen Lehrstuhl für Palliative Care und Organisationsethik berufen, später lehrte und forschte er an der Karl-Franzens Universität Graz. Heute ist er unter anderem Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des dortigen Zentrums für Interdisziplinäre Alterns- und Care-Forschung (CIRAC) sowie des Deutschen Hospiz- und Palliativ Verbandes e.V. (DHPV).
Hinweis:
In der Tagung “Die Krisengesellschaft braucht Hospizlichkeit” beschäftigen wir uns vom 22. bis 23. März 2023 mit Hospizarbeit und Palliative Care in einer sich wandelnden Gesellschaft. Auf der Tagung, die die Reihe der Tutzinger Hospizgespräche fortführt, wird auch Andreas Heller referieren. Sein Thema: “Zehn Erkenntnisse aus mehr als 30 Jahren Hospizarbeit und Palliative Care”. Unter diesem Link finden Sie Informationen zum genauen Ablauf und den Anmeldemodalitäten.
Bild: Adobe Stock