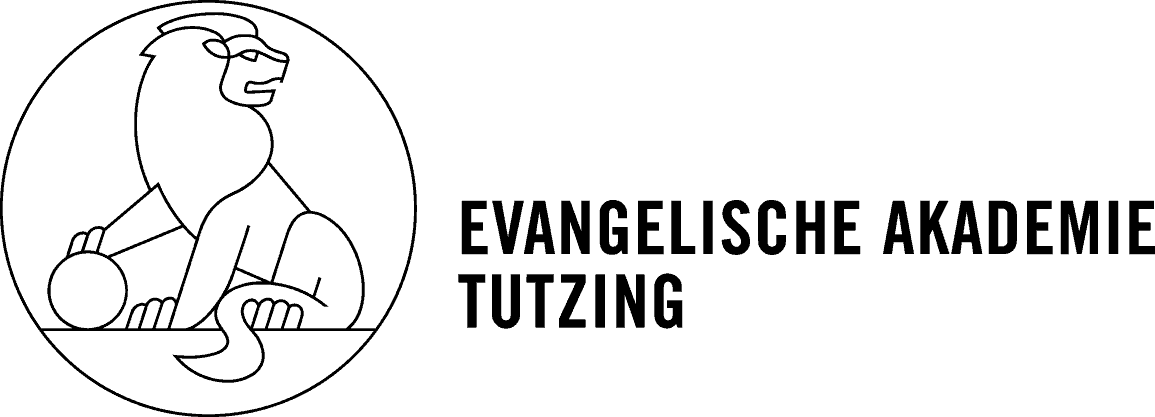Erinnerung gegründet auf Wissen – Das NS-Dokumentationszentrum München
Der Münchner Freundeskreis der Evangelischen Akademie Tutzing hat in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. Den Festvortrag hielt der Architekturhistoriker Winfried Nerdinger, Gründungsdirektor des NS-Dokumentationszentrums München und Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. An dieser Stelle können Sie die Rede nun nachlesen.
In seinen Briefen zur Beförderung der Humanität schrieb Johann Gottfried Herder: „Aus Geschichte wird Erfahrung, aus Erfahrung wird Erinnerung und Erinnerung bildet den lebendigsten Teil unserer praktischen Vernunft und damit unseres Menschseins.“ Erinnerung und Menschsein gehören unmittelbar zusammen. Aber wie erinnert man sich an etwas? Ganz generell gilt: Erinnerungen sind nicht präsent, sie müssen geweckt und ins Bewusstsein geholt werden. Dieses Hervorholen des Vergangenen kann auf verschiedene Weise – beispielsweise durch Bilder, Begriffe, Gerüche, Orte oder eine spezifische Situation – ausgelöst werden. Das berühmteste Beispiel dafür hat Marcel Proust in seinem Roman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ beschrieben: Der Geschmack einer in Lindenblütentee getauchten Madelaine lässt dem Erzähler seine Jugend in Combray mit allen Details in seiner Erinnerung wiedererstehen. Die verlorene Zeit wird zur erinnerten Gegenwart.
Diesem individuellen Erinnern steht das kollektive Gedächtnis gegenüber, ein Begriff, den der französische Soziologe Maurice Halbwachs in den 1920er-Jahren in den wissenschaftlichen Diskurs eingeführt hat. Jan und Aleida Assmann, die dieses Thema seit Jahrzehnten untersuchen, sprechen vom kulturellen Gedächtnis, das sie als eine Art Speicher verstehen, in dem Ereignisse und identitätsstiftende Fakten von Gruppen oder Völkern über Generationen hinweg gesammelt, weitergetragen und weitergegeben werden. Da die Inhalte in diesem Speicher immateriell sind, müssen sie zur Weitergabe über Rituale, Gedenkfeiern oder Medien wie Bücher, Bauten, Fotos oder Denkmäler materialisiert werden. Der französische Historiker Pierre Nora hat erstmals die „lieux de mémoire“, die Erinnerungsorte Frankreichs untersucht und dahingehend definiert, dass sich mit bestimmten Namen, wie „Jeanne d’Arc“, mit kalendarischen Anlässen, wie dem 14. Juli, oder mit Orten, wie der Bastille, die kollektive Erinnerung gleichsam verdichtet, er spricht deshalb von den „lieux de mémoire“ als den Kristallisationspunkten der Erinnerung. Ort ist also metaphorisch zu verstehen, auch die Parole „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ wird als zentraler französicher Erinnerungsort interpretiert.
Erinnerungsorte können somit von materieller Substanz gelöst sein, sie werden dann zu symbolischen Orten (die Bastille ist nicht mehr vorhanden), über die man in die Tiefe der Geschichte gehen kann. „Tief ist der Brunnen der Vergangenheit“, so lautet das Leitmotiv des Josephromans, mit dem Thomas Mann, anknüpfend an den Brunnen, in den der biblische Josph geworfen wurde, die ägyptische Kultur mit all ihren Facetten aus der Geschichte wieder hervorholte. Insbesondere über die Evokation von Orten erfolgt der Einstieg in die Erinnerung, deshalb genügt es, Auschwitz, Stalingrad, Hiroshima oder Dachau zu sagen, und es entstehen Bilder die eine individuelle oder kollektive Erinnerung in Gang setzen.
Die Bedeutung von Orten bei der Erinnerung hat sich im Laufe der Entwicklungsgeschichte genetisch in unser Gedächtnisvermögen eingeschrieben, d.h. unser Gedächtnis ist topologisch, ortsbezogen strukturiert. Darauf basiert auch seit der Antike die intensivste Form Mnemotechnik: Was erinnert werden soll, wird mit einem Ort verknüpft, so entsteht ein ganzes „Haus der Erinnerung“ und beim Durchgang durch dieses Haus kann Schritt für Schritt das zu Erinnernde wieder abgerufen werden. Die größten Gedächtnisleistungen folgen immer diesem Prinzip.
In den historischen Ort ist Geschichte eingeschrieben und über das Gedächtnis kann die Historie gleichsam wieder aus der Materie hervorgeholt werden. Aber ein Ort hält Erinnerungen nur dann über Generationen fest und wird zum Kristallisationspunkt für das kulturelle Gedächtnis, wenn Menschen dafür Sorge tragen, dass das spezifische Ereignis mit dem Ort verknüpft bleibt. Die Orte und Bauten selbst sind stumm und können nur „mit Hilfe der im Gedächtnis bewahrten Überlieferung zum Sprechen gebracht werden“ (Assmann). „Man muss mit dem Blick und dem Wissen des Archäologen sehen“, benannte der französische Kulturwissenschaftler Georges Didi-Huberman diese nachhaltigste Form der Erinnerung. Dabei kann zwischen einer „ortsfesten Gedenkpraxis“ und einem „übertragenen Gedächtnis“ unterschieden werden. Auf einem Friedhof kann man auf ein Grab oder beim Geburtshaus eines Dichters in einen Raum zeigen und das Gedächtnis verbindet sich mit dem Ort: „Hier ist es gewesen“. Das Erinnern kann aber auch übertragen werden, beispielsweise auf ein Denkmal oder Monument, dann wird „der Gedenkinhalt mit künstlerischen Mitteln“ symbolisch repräsentiert, das Gedenken wird ortsunabhängig. Für die Praxis des Gedenkens ist es in beiden Fällen notwendig, die Erinnerung durch Riten, Kulte o.ä., also durch „bestimmte Formen einer kulturellen Mnemotechnik“ (Assmann) zu festigen.
Das kulturelle Gedächtnis kann allerdings auch konstruiert und instrumentalisiert werden. Seit den Untersuchungen des englischen Historikers Erik Hobsbawm zur „Invention of Tradition“, zur Erfindung von Tradition, wissen wir, dass viele Traditionen und insbesondere nationale Identitätsvorstellungen gezielt erfunden, beziehungsweise konstruiert worden sind. Valentin Groebner hat jüngst in seiner Publikation „Retroland“ einige erstaunliche Beispiele für derartige konstruierte Traditionen zusammengestellt. So wurde beispielsweise der venezianische Karneval in seiner heutigen Form zum ersten Mal 1867 abgehalten, mit dem erklärten Ziel, „Fremde anzuziehen, die Geld bringen“, und die Landshuter Fürstenhochzeit, Inbegriff einer bayerischen Traditionspflege, geht nur auf das Jahr 1903 zurück. Entscheidend für den Erfolg ist die gleichbleibende Gestaltung und das regelmäßige Abhalten dieser Veranstaltungen, mit denen im Sinne einer kulturellen Mnemotechnik Traditionen konstruiert wurden.
Die Erinnerung an die NS-Zeit und den Holocaust war in den vergangenen Jahrzehnten von heftigen Diskussionen über die Frage begleitet, ob etwa Auschwitz überhaupt bildhaft vermittelt werden könne und dürfe. Claude Lanzman hat dies – insbesondere mit Blick auf filmische Inszenierungen à la Spielbergs „Schindlers Liste“ – heftig verneint und mit seinem Film „Shoah“ eine rein auf dem Wort von Zeitzeugen und den historischen Orten basierende, dokumentierende Erinnerung vorgeführt. Gegen Lanzman hat Georges Didi-Huberman in seiner Publikation „Bilder trotz allem“ die Bedeutung des sinnenhaft Erfahrenen für die Erinnerungskultur proklamiert und erklärt: „Um zu wissen, muß man sich eine Bild machen“. Demnach muss man sich auch ein Bild von dem machen, was erinnert werden soll. Und umgekehrt gilt: wer sich kein Bild machen kann, kann nichts erinnern.
Auch die Präsentation der Geschichte am NS-Dokumentationszentrum München basiert auf Bildern, aber mit den Bildern soll „Erinnerung auf Wissen gegründet“ werden, das ist der zentrale Ansatz der Erinnerungsarbeit. Der lange und mühsame Weg zu diesem Erinnerungsort und die Umsetzung der Konzeption sollen im Folgenden kurz skizziert werden.
Im März 1946 ließ der damalige Münchner Oberbürgermeister Karl Scharnagl ein bislang namenloses Rondell beim Schillerdenkmal an der Brienner Straße als „Platz der Opfer des Nationalsozialismus“ benennen. Ein Straßenschild wurde aufgestellt und für die nächsten 20 Jahre war dieses Schild der einzige direkte Hinweis auf den Nationalsozialismus im öffentlichen Raum der ehemaligen „Hauptstadt der Bewegung“. Als dieses Rondell im Zuge der Planung des Altstadtrings in eine Verkehrsinsel umgewandelt wurde, wurde 1965 neben dem Straßenschild ein Granitfindling mit der Inschrift „Den Opfern des Nationalsozialismus“ aufgestellt. Dieser Stein auf einer Verkehrsinsel ohne postalische Adresse blieb für die nächsten zwei Jahrzehnte der einzige Hinweis im öffentlichen Raum der Stadt auf die NS-Zeit. 40 Jahre nach Kriegsende war man sich dann endlich auch im Münchner Stadtrat der Peinlichkeit dieses Ortes bewusst, nun wurde ein Wettbewerb für Künstler in Oberbayern (!) ausgeschrieben und an die Stelle des Steines kam 1985 eine Stele mit einem Metallkäfig, in dem ausgerechnet eine Gasflamme brannte – die Inschrift blieb gleich: „Den Opfern des Nationalsozialismus“. Eine Peinlichkeit wurde durch eine andere ersetzt. In diesem Zustand blieb die Verkehrsinsel die folgenden 28 Jahre, dann kam es 2013, 68 Jahre nach Kriegsende, zu einer Umgestaltung mit einem zusätzlichen Metallband, auf dem die Verfolgtengruppen benannt werden. Ein Gedenkort ist nicht daraus geworden.
John Dewey, der große amerikanische Philosoph der Demokratie, hat immer wieder auf den grundlegenden Zusammenhang von Zeichen im öffentlichen Raum und der Entwicklung eines demokratischen Gemeinwesens hingewiesen. In München wie andernorts ist diese Bedeutung des öffentlichen Raums als Ort repressionsfreier Kommunikation sowie demokratischer und historischer Bewusstseinsbildung (Habermas) bis heute vielfach nicht verstanden oder sogar unterdrückt worden.
„Den Opfern des Nationalsozialismus“ oder „Den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft“, das waren die üblichen Formeln in der gesamten Bundesrepublik, mit der sich die Nachkriegsgesellschaft vor allem dem eigenen Schicksal, den Gefallenen, Vertriebenen, Kriegsheimkehrern und Ausgebombten zuwandte und durch Selbstviktimisierung die spezifisch deutsche Schuld an den nationalsozialistischen Massenverbrechen ausblendete. Sigmund Freud bezeichnete diesen Vorgang als „Deckerinnerung“: Bestimmte Erinnerungen werden abgedrängt und durch andere Erlebnisse überlagert. Erinnerungsbilder werden produziert, um andere zuzudecken. Die Deckerinnerung dient nicht zum Erinnern, sondern um zu vergessen. Der Krieg wurde im Gedächtnis der Nachkriegsgesellschaft zum Erlebnis der NS-Zeit und der eigenen Opferrolle, die Täter und die Verbrechen wurden dagegen verdrängt. Kennzeichen der frühen Bundesrepublik ist eine „Tabuisierung der Verbrechen“ wie der Soziologe Rainer Lepsius treffend zusammenfasste, und dieser Tabuisierung korrespondiert eine nahezu komplette „Verweigerung des Erinnern-Wollens“ (Sigrid Weigel).
1954 richtete Raul Hilberg erstmals den Blick auf die Trias von „Täter, Opfer und Zuschauer“ – die Publikation seines Standardwerks wurde verhindert und erschien in Deutschland erst 1982. Die Auseinandersetzung mit den Tätern erfolgte erst allmählich seit den 1960er-Jahren und wurde dann zum zentralen Thema der nächsten Generation. Erst durch den Blick auf die Täter kam es zur Abscheu vor den Taten und damit erst zur Anteilnahme an den Opfern. Erst durch den Versuch, sich wenigstens das Leid der Opfer vorzustellen, wurden die Täter verabscheuungswürdig. An die Stelle der als „Vergangenheitsbewältigung“ deklarierten Verdrängung trat das, was wir heute als „Erinnerungskultur“ bezeichnen. Unter Demokraten herrscht heute ein Konsens, dass wir in Deutschland eine Pflicht zur Erinnerung an die NS-Zeit haben, während bezeichnenderweise von Rechtspopulisten eine Revision der Erinnerung an eine Zeit gefordert wird, die als „Vogelschiss in der deutschen Geschichte“ gezielt marginalisiert werden soll. Diese Form von Geschichtsrevisionismus ist ein fast durchgängiges Kennzeichen rechtsnationalen Denkens.
In München, der ehemaligen Hauptstadt der Bewegung, verlief die Entwicklung zu einer Erinnerungskultur im öffentlichen Raum noch lange Zeit gegenläufig zu anderen Städten in der Bundesrepublik. Noch 1988 wurde das größte NS-Ensemble in der Stadt, die Aufmarschanlage zum Blut- und Todeskult des 9. November am Königsplatz, abgebrochen und der Platz in den Zustand der Klenzezeit zurückgebaut. Politiker aller Parteien waren sich einig, den Schandfleck aus der schönen „Weltstadt mit Herz“ verschwinden zu lassen.
Zum Rückbau gehörte auch die Ausschreibung eines Wettbewerbs durch den Freistaat Bayern zur Überbauung der Sockel der ehemaligen Ehrentempel mit Museen. Das ehemalige sog. „Forum der Bewegung“, der zentrale Kultort der NSDAP, sollte aus der Erinnerung gelöscht werden. Die prämierten Vorschläge zur Geschichtsverdrängung führten aber in der Öffentlichkeit zu einer massiven Kritik. Mit dem Aufbrechen der Granitplatten, brach gleichsam auch die versiegelte Erinnerung an die NS-Zeit wieder auf. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, Laien wie Fachleute, lehnten das Vorhaben ab, Stadtteilgruppen und Geschichtsvereine intervenierten und wurden dabei von der Presse unterstützt, so dass sich der Freistaat von dem Vorhaben schnell verabschiedete.
Diese öffentliche, zivilgesellschaftliche Artikulation des Wunsches nach Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte der Landeshauptstadt kann als Geburtstunde des NS-Dokumentationszentrums bezeichnet werden, denn nun waren die Bemühungen, einen Erinnerungsort an die NS-Zeit in München zu schaffen, nicht mehr aufzuhalten. Ein entscheidendes Element in diesem Prozess war der Vorschlag, das NS-Dokumentationszentrum auf dem Grundstück des ehemaligen Braunen Hauses, der NS-Parteizentrale, zu errichten. Direkt auf diesem Täterort, dem Ort, an dem Verbrechen geplant worden waren, sollte an die NS-Zeit erinnert und darüber aufgeklärt werden.
Der Zusammenhang zwischen Tätern und Opfern, zwischen Täterort und Opferort ist nicht auflösbar, aber es ist ein fundamentaler Unterschied, ob man sich in einem ehemaligen Konzentrationslager befindet und dort der Gequälten und Ermordeten gedenkt – deshalb werden dort auch Gedenkstätten eingerichtet – oder ob an Orten wie einer ehemaligen Gestapozentrale, dem Reichsparteitagsgelände oder eben dem Münchner Parteiviertel insbesondere an die Täter erinnert und über sie aufgeklärt wird. Ein Folterkeller und ein Schreibtischtäter gehören inhaltlich und kausal zusammen, aber am Ort der Opfer sind Empathie und Sensibilität gefordert, vergleichbar dem angemessenen Verhalten auf einem Friedhof, während am Ort der Täter Zusammenhänge, Strukturen und Tatmotive einsichtig gemacht werden müssen. „Lernen am historischen Ort“ unter Einbeziehung der geschichtsträchtigen Umgebung war deshalb Ausgangspunkt und Zielsetzung für das NS-Dokumentationszentrum, das dann 2015 – 70 Jahre oder drei Generationen nach Kriegsende – auf dem Gelände des ehemaligen Braunen Hauses eröffnet werden konnte. Der in einem Wettbewerb prämierte weiße Betonwürfel sollte dabei bewusst als „Störfaktor“ im Gefüge der rechtwinklig angelegten Straßenzüge des Stadtteils wirken.
Die Dauerausstellung beginnt im vierten und endet im ersten Obergeschoss, wo sich auch der Raum für Sonderausstellungen befindet. In den beiden Untergeschossen sind Räume für eine individuelle Vertiefung und pädagogische Gruppenarbeit sowie ein Auditorium für Veranstaltungen. Das NS-Dokumentationszentrum ist so konzipiert, dass an diesem historischen Ort geschichtliche Ereignisse und Zusammenhänge als Gegenstände des Wissens vermittelt werden. Erinnerung soll auf Wissen gegründet werden, nicht zuletzt auch deshalb, weil das Wissen über den Nationalsozialismus in der breiten Bevölkerung zunehmend abnimmt, fast gegenläufig zu den ständig wachsenden Kenntnissen aus wissenschaftlichen Forschungen. Für diese Wissensvermittlung ist die mnemotechnisch so wichtige Verknüpfung von Ort und Erinnerung ein grundlegender Bestandteil des Ausstellungskonzepts. So wurde vor der Eröffnung des Neubaus der völlig zugewachsene Sockel des gegenüberliegenden nördlichen „Ehrentempels“ von Vegetation befreit, so dass er erstmals seit Jahrzehnten überhaupt wieder wahrgenommen werden konnte. Als eine Art „stummer Zeuge“ konfrontiert er sowohl Besucher wie Vorbeigehende wieder mit der verdrängten NS-Geschichte, die im Dokumentationszentrum dann dargestellt und kritisch reflektiert wird. Bereits auf der Terrasse vor dem Eingang wird der spezifische historische Ort auf einer Stele erklärt. Und beim Gang durch die Dauerausstellung wird immer wieder die historische Darstellung durch einen Blick aus dem Fenster mit den historischen Orten verknüpft.
Die Ausstellung ist so aufgebaut, dass Informationen je nach Interesse und Verweildauer auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlicher Tiefe präsentiert werden. Im Hinblick auf eine Besuchszeit von durchschnittlich eineinhalb bis zwei Stunden ist die Dokumentation in insgesamt 33 Themenschwerpunkte so gegliedert, dass in komprimierter Form verständlich und begründet die Ereignisse und Zusammenhänge vermittelt werden. Diese Themenschwerpunkte sind als vertikal angeordnete, großformatige Leuchtrahmen gestaltet, die den Besucher durch die Ausstellung leiten. Das zu vermittelnde Thema wird jeweils als Großbild visualisiert, das mit einem kleineren Bild konfrontiert und damit inhaltlich vertieft wird, während ein knapper Text auf Deutsch und Englisch die Zusammenhänge erläutert. Optischer Eindruck und Erklärung von Kontext und Strukturen greifen ineinander.
Da Bilder immer auch zeitgebundene Informationen und den subjektiven Blickwinkel des Fotografen transportieren, werden sie kontextualisiert und bildkritisch erläutert. Diese erste, vertikal angeordnete Informationsebene, die mit Filmen und Karten ergänzt wird, ist mit einer horizontal gestalteten zweiten Ausstellungsebene verbunden, die zur Vertiefung der Leitthemen einlädt. Eine dritte Vertiefungsebene mit Computern befindet sich im Untergeschoss. Die Besucherinnen und Besucher entscheiden selbst, je nach Interesse und Zeit, welche und wie lange sie Themen vertiefen wollen.
Die erste Ausstellungebene im 4. Obergschoss ist der Entstehungs- und Aufstiegsphase der NSDAP gewidmet. Sie beginnt mit der Katastrophe des Ersten Weltkriegs und dem Ausbruch der Novemberrevolution im Jahr 1918 und endet mit der sog. „Machtergreifung“. Leitfragen sind „Warum München?“, welche gesellschaftlichen und politischen Bedingungen machten den Aufstieg Hitlers möglich, und: „Warum scheiterte die Demokratie?“ Am Ende steht die Etablierung Münchens als Hauptstadt der Bewegung und die Errichtung des Parteiviertels, dessen Bauten über einen Grundriss und einen Blick aus dem Fenster genau lokalisiert werden können. Auf diese Weise werden die historischen Zusammenhänge verräumlicht – „Im Raume lesen wir die Zeit“ (Schlögel) – und sie werden konkretisiert: „Hier ist es gewesen“. Mit diesem verweisenden „Hier“ werden die Orte und Bauwerke zu Trägern und Zeugen des kollektiven Gedächtnisses und gleichzeitig wird die indivuduelle Erinnerung vertieft. Zudem erfährt der Besucher unmittelbar, hier wird nichts inszeniert oder virtuell imaginiert.
Im dritten Obergeschoss wird die Konsolidierung der NS-Macht dargestellt. Die Leitfrage zielt auf die Mechanismen der NS-Herrschaft mittels Inklusion und Exklusion: wie wurde versucht, eine homogene rassistische „Volksgemeinschaft“ zu erschaffen, wie erfolgte die Ausgrenzung von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen? Die Ausstellung zeigt die stetige Radikalisierung und den Weg in Krieg und Vernichtung. Genau an der Stelle des Ausstellungsrundgangs, an der die Besucher über einen großen Luftraum auf den sog. „Führerbau“ und auf den Königsplatz blicken können, werden die Unterzeichnung des Münchner Abkommens 1938 und der Kult des 9. November präsentiert. Der Besucher sieht die beiden historischen Ereignisse in Filmen, die vor dem dahinter befindlichen, realen historischen Ort projiziert werden.
Der Luftraum ermöglicht zudem, eine zweite Zeitebene einzubeziehen, denn man kann hinunterblicken ins nächste Geschoss, in dem die Zeit nach 1945 behandelt wird. Die Unterzeichnung des Münchner Abkommens und der Totenkult werden als Weg in Krieg und Verbrechen ablesbar und die Folgen werden wieder vor dem historischen Ort auf einem Film sichtbar: Die Ehrentempel werden nach Kriegsende gesprengt und der Führerbau wird zum Amerikahaus, dem Ort der Entnazifizierung und Rückführung zur Demokratie.
Die Verankerung der NS-Geschichte im Münchner Stadtraum ist ein zentrales Element der Vermittlungs- und Erinnerungsarbeit. Mit dem Ableben der Zeitzeugen können die historischen Orte die Aufgabe der Zeugenschaft übernehmen, denn mit ihnen kann Geschichte eindrücklich und dauerhaft an die folgenden Generationen vermittelt werden. Alle pädagogischen Untersuchungen haben diese enorme Wirkkraft des historischen Orts für die Erinnerung bestätigt. Historische Orte sind das beste Mittel, um Erinnerung hervorzuholen bzw. zu wecken.
Im zweiten Obergeschoss werden die rassistische Ausgrenzungsgesellschaft und ihre Opfer – darunter auch Zwangsarbeiter und Widerständige – im Zweiten Weltkrieg behandelt. Es folgen die Fragen nach Aufarbeitung und Verdrängung, nach dem Umgang Münchens mit der Rolle als „Hauptstadt der Bewegung“. Den Abschluss bildet die Dokumentation der Nachwirkungen und des Wiederauflebens von nationalsozialistischen Gedanken sowie der Antworten der Zivilgesellschaft. Am Ende der Ausstellung werden die Besucherinnen und Besucher über zwei große Bildschirme mit tagesaktuellen Meldungen von Nachrichtenagenturen und Leitmedien zu Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und Antisemitismus konfrontiert. Der Besucher ist in der Gegenwart angekommen und kann das Leitthema der ganzen Dokumentation „Das geht mich heute noch etwas an“ mit in sein tägliches Leben nehmen. Die Dokumentation der NS-Geschichte wird somit zum Aufruf gegen das Vergessen und zum Anstoß zur Reflexion über die eigene Verantwortung für die Bewahrung demokratischer Werte. Diese Erinnerungsarbeit kann dann im Lernforum im Untergeschoss anhand von Computern mit Datenbanken sowie an speziellen Touch Tables einzeln oder in Gruppen weiter vertieft werden.
Das NS-Dokumentationszentrum ist ein Lern- und Erinnerungsort an einem Täterort, Ziel ist eine objektivierte Kontextualisierung und evidente Vermittlung historischer Zusammenhänge. Es geht um Erklärung und Verstehen oder mit den Worten Klaus von Dohnanyis: „Wir brauchen die rücksichtslose Aufklärung, wir brauchen ein helles Licht, um die dunkle Vergangenheit wirklich auszuleuchten.“
Lernen sollte man aus der rationalen, kritisch distanzierten Auseinandersetzung mit den Tätern. Diesem Ansatz stehen Inszenierung und Emotionalisierung entgegen, denn sie sind Elemente einer Ästhetisierung wie auch einer Instrumentalisierung der Historie. So arbeiten bezeichnenderweise das von der konservativen Fidesz-Regierung in Budapest gegründete „Haus des Terrors“ oder das von der Kaczynski-Regierung errichtete „Museum zum Warschauer Aufstand 1944“ mit extrem aufwendigen inszenatorischen Mitteln. Es sind Erlebnismuseen, in denen die Besucher selbst in bestimmte Rollen schlüpfen, beziehungsweise sich mit bestimmten Personen und Vorstellungen, die farbig, lautstark und möglichst dreidimensional präsentiert werden, identifizieren können. Die Besucher sollen gar nicht differenzieren und historische Kontexte erfassen, sondern erinnerungspolitisch vorgefasste Lehrmeinungen wie bei einem Kinobesuch aufnehmen. Der Philosoph Klaus Heinrich hat schon vor Jahren, als die museal aufbereiteten Geschichtsinszenierungen in Mode kamen, auf deren Intention und immanente Problematik hingewiesen. Dies ist, „eine Form der Erinnerung, die gegen ‚Durcharbeiten’ feit, […] Die Farben der Geschichte werden aufgetragen, die Fragen an die Geschichte abgeschnitten.“ Die Inszenierung von Geschichte macht historische Ereignisse mit medialen Mitteln leicht konsumierbar, macht sie interessant, aber löst sie dafür aus ihren komplexen Bedingungszusammenhängen. Geschichte reiht sich ein in die tägliche Unterhaltung, deren Aufmerksamkeits- und Reizwert kontinuierlich gesteigert und übertroffen werden muss, damit er wirksam bleibt. Wer somit glaubt, die Vermittlung von Nationalsozialismus und Holocaust interessant oder emotional machen zu müssen, begibt sich schon auf den Weg der Affirmation und des Konsumierens.
Genau aus diesem Grund wurde am NS-Dokumentationszentrum München jede Form von Inszenierung abgelehnt und konsequent die Auffassung vertreten, dass an einem Erinnerungs- und Lernort zum Nationalsozialismus Geschichte nicht unterhaltsam, sondern einsichtig gemacht werden muss (Untersuchungen zeigen, dass über Internet und Filme nahezu keine Geschichtskenntnisse vermittelt werden). Memoria und Ratio, Erinnerung und Vernunft – nicht Emotionalisierung – gehören zusammen. Deshalb werden in der Dauerausstellung durchgehend Fragen gestellt, denn die Frage nach den Gründen ist die Grundlage jeder Suche nach Erkenntnis – causas rerum cognoscere – und zu den Fragen werden historisch gesicherte Fakten zum Lernen und eigenen kritischen Nach- und Weiterdenken angeboten. Vorurteile wie Antisemitismus oder Xenophobie können nur durch Aufklärung und Wissen bekämpft werden (eine Aktualisierung steht deshalb am Ende des Lernens aus der Geschichte!).
Die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit muss auf „hellem Bewusstsein“ basieren, schrieb Adorno in seinem immer noch maßstabsetzenden Beitrag zur Frage „Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit?“ Das NS-Dokumentationszentrum ist ein Lernort, und deshalb steht im Zentrum der pädagogischen Arbeit der Satz von Adorno zur Erziehung nach Auschwitz: „Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. […] Man muss die Mechanismen erkennen, die die Menschen so machen, dass sie solcher Taten fähig werden, muss ihnen selbst diese Mechanismen aufzeigen und zu verhindern trachten, dass sie abermals so werden […] Die einzig wahrhafte Kraft gegen das Prinzip von Auschwitz wäre Autonomie […] die Kraft zur Reflexion, zur Selbstbestimmung, zum Nicht-Mitmachen.“ Im NS-Dokumentationszentrum soll diese Kraft zur Reflexion und damit zum „Nie-wieder“-Mitmachen durch Wissen gestärkt werden.
Diese Kraft kann aber nicht allein aus der Ratio, der Auseinandersetzung mit den Tätern, kommen, wir setzen uns ja auch nicht mit den Tätern um der Täter willen auseinander, sondern wegen der Opfer. Und deshalb gehört zum Erinnern das, was Walter Benjamin das Eingedenken genannt hat. Die Erinnerung an vergangenes Leid und geschehenes Unrecht kann dieses nicht wieder gut machen, aber mit dem Eingedenken an die Opfer bleibt deren Leid etwas Unabgeschlossenes, für die Zukunft Verpflichtendes, und aus dem Eingedenken entsteht die Kraft zu einer fortdauernden sühnenden Erinnerung. Durch Erinnerung allein ist Geschichte noch nicht für Gegenwart und Zukunft wirksam. Durch das Eingedenken erhalten die Toten einen Sinnzusammenhang und einen Bezug zur Gegenwart, und erst dadurch wird aus erinnerter Geschichte eine begriffene und verpflichtende Geschichte: „Wir können uns unsere Traditionen nicht aussuchen, aber wir können wissen, dass es an uns liegt, wie wir sie fortsetzen“ (Habermas).
Und Adorno hat sogar schon vor über einem halben Jahrhundert hellsichtig die größte Gefahr benannt, die zu einer Wiederkehr der Barbarei führen könnte: „Morgen kann eine andere Gruppe drankommen als die Juden, etwa die Alten […] oder die Intellektuellen, oder einfach abweichende Gruppen. Das Klima […], das am meisten solche Auferstehung fördert, ist der wiedererwachende Nationalismus.“ Heute, im Jahr 2019, müssen wir leider sagen, diese Gefahr steht bereits vor der Tür. Genau deshalb ist eine auf Wissen gegründete Erinnerung, wie sie im NS-Dokumentationszentrum vermittelt wird, so wichtig.
Winfried Nerdinger
Zum Bericht über das Jubiläum des Münchner Freundeskreises gelangen Sie hier.
Bild: Prof. Winfried Nerdinger (Foto: Eckert / Heddergott TU München)