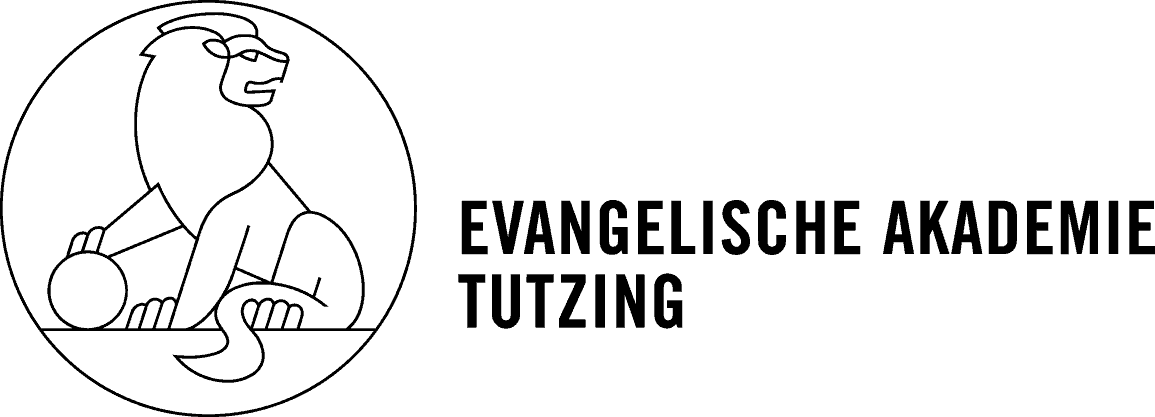Den Menschen im Blick
Die letzten acht Jahre vor seinem Ruhestand hat Pfarrer und Pastoralpsychologe Frank Kittelberger als Studienleiter an der Evangelischen Akademie Tutzing gearbeitet. Wenn man ihn nach seinen Themen fragte, pflegte er augenzwinkernd zu sagen „Tod und Sterben“. Dass das, was er damit meinte, nicht in drei Worten zu beschreiben ist – geschenkt. Wir haben uns aus diesem Grund Zeit für ein ausführliches Gespräch mit Frank Kittelberger genommen.
Evangelische Akademie Tutzing: Herr Kittelberger, acht Jahre lang waren Sie nun Studienleiter an der Evangelischen Akademie Tutzing. An welche Erlebnisse Ihrer Arbeit hier werden Sie sich noch lange erinnern?
Frank Kittelberger: Diese Frage lässt sich wirklich nicht einfach beantworten. Es waren spannende Jahre am Ende meiner beruflichen Laufbahn, die mich viele Dinge noch einmal neu haben durchdenken und beurteilen lassen. Ich habe unheimlich viel gelernt. Im Zentrum dieser Arbeit steht natürlich die menschliche Begegnung. Und hier war es ein Geschenk für mich, Menschen zu Vorträgen und Workshops einladen zu können, die ich immer schon einmal kennenlernen wollte. An die Begegnungen mit Eugen Drewermann, Klaus Dörner, Krista Sager, Tilmann Moser, Konstantin Wecker und manch andere Berühmtheit werde ich ebenso gern zurückdenken, wie an das Kennenlernen vieler mir unbekannter aber sehr interessanter Menschen. Kluge Philosophinnen lehren und schreiben in Deutschland in viel größerer Zahl, als mir bewusst war. Politiker und auch zwei Nobelpreisträger durfte ich bei meinen Tagungen ebenso begrüßen, wie Ethiker und Ethikerinnen von Rang und Namen. Ja, ich glaube diese Begegnungen sind es, die ich mir immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen werde.
Ihrem Referat waren mehrere Gebiete zugeordnet: Ethik in Medizin und Gesundheitswesen, Pastoralpsychologie und Spiritual Care. Was vereint diese Gebiete?
Es ist der Blick auf den Menschen. In Grenzsituationen wie Krankheit oder Sterben sind Menschen auf das zurückgeworfen, was sie wirklich trägt und ausmacht. Diesem Kern sollten wir uns – bei aller medizinisch-technischen Professionalität – mit Liebe und Sorge nähern, wenn wir Menschen begleiten oder ihnen gar helfen möchten. Diese Fragen beschäftigen uns in der Medizinethik und in der Pflegeethik, in der Diskussion unseres Gesundheitswesens und in der psychologischen und seelsorgerlichen Zuwendung. Ich glaube, darin könnte eine Verbindung der Themenfelder liegen, die ich zu bearbeiten hatte.
Ihre Zeit an der Akademie in Tutzing war die letzte Station eines gut gefüllten Arbeitslebens. Sie hatten vorher schon als Krankenhausseelsorger und in der Altenhilfe gearbeitet. Sie sind nicht nur Pfarrer, sondern haben auch Zusatzausbildungen in Pastoralpsychologie, Supervision und tiefenpsychologischer Gruppendynamik absolviert und über viele Jahre eine pastoralpsychologische Pfarrstelle bei der Inneren Mission München bekleidet. Inwiefern hat diese Arbeitserfahrung Ihre Arbeit in Tutzing geprägt?
Nun, es waren alles Erfahrungen, die ich mitgebracht habe: Berufserfahrung, Lebenserfahrung, Selbsterkenntnis – alles gute Voraussetzungen, um jetzt noch einmal neu diese Erfahrungen reflektieren, durchdenken und in einen breiteren Horizont stellen zu können. Insofern hat sich beides gegenseitig befruchtet: Die Vergangenheit hat meiner Arbeit als Studienleiter Substanz und Erdung gegeben und die Erkenntnisse aus der Akademiearbeit haben viele dieser Erfahrungen nochmals in einem breiteren Deutungshorizont verankert.
Ich würde gerne einen Streifzug durch Ihre Fachgebiete unternehmen, um Debatten aus diesen Gebieten einen Raum zu geben. Wenn Sie an Ethik in der Medizin und im Gesundheitswesen denken: Was waren die größten Entwicklungen in den vergangenen Jahren?
Natürlich ist die gegenwärtige Coronakrise ein Brennpunkt für viele aktuelle Themen der Medizinethik. Wir diskutieren die Prioritäten bei Ressourcenknappheit unter dem Stichwort der Triagierung. Das ist eine schwierige Frage, wenn Medizinerinnen und Mediziner im Zweifelsfall eine schnelle Entscheidung darüber treffen müssen, wen sie behandeln und wen nicht. Aber auch die weiterreichende Frage der Allokation beschäftigt unser Gesundheitswesen seit Jahren. Wie verteilen wir Ressourcen, die niemals für die gesamte mögliche Versorgung ausreichen? Dabei wird nicht alles öffentlich diskutiert, aber jede dieser Entscheidungen hat Auswirkungen. Da geht es um sehr teure Medikamente für besonders seltene Krankheiten, die im Zweifelsfall von der Allgemeinheit bezahlt werden und im Einzelfall zu helfen. Es geht auch um die Gewichtung von sprechender Medizin im Verhältnis zur pharmakologischen Behandlung und operativen Eingriffen.
Ein weiteres spannendes Thema war und ist das Verhältnis von Autonomie und Fürsorge, von Freiverantwortlichkeit und der nur langsam nachlassenden paternalistischen Sicht auf die Medizin. Je mehr Autonomie und Mitsprache die Patientinnen und Patienten haben, desto wichtiger ist dann aber auch eine gute und umfassende Information. All dies sind schwierige Fragen. In der Frage der Sterbehilfe und des assistierten Suizids geraten Medizin und Pflege nicht nur oft an die Grenzen ihres eigenen Berufsethos, sondern sie sind zunehmend gezwungen, den Austausch mit anderen Berufsgruppen zu suchen. Das ist eigentlich eine gute Entwicklung, bedarf jedoch noch viel umfassendere Schulung in der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten. In diesem Zusammenhang wird es auch unvermeidbar sein, endlich die pflegenden Berufe aufzuwerten und aus der hierarchischen Unterordnung herauszulösen. Eine gute Fachpflegekraft in der Altenpflege ist nicht weniger wert und hat nicht weniger zu sagen, als der Krankenhausarzt oder die Hausärztin. Doch so weit sind wir in der Realität leider noch nicht. Fragen der technischen Assistenz und möglicher Unterstützung von Pflege und Medizin durch Roboter sind genauso spannend, wie die damit verbundenen kritischen Rückfragen auf die Datensicherheit in diesem Feld. Die Beziehung zwischen Therapeut und Patient ist etwas sehr geschütztes und kann sich nicht einfach im digitalen Nirwana auflösen. Hier haben wir noch viel in Sachen Datensicherheit und Datensouveränität zu besprechen.
Wie sieht es in der Pastoralpsychologie aus – hat sich dieses Spezialgebiet theologischer Tätigkeiten verändert, wenn Sie die Jahre im Geiste noch einmal durchgehen?
Auf dem Gebiet des Miteinanders von Theologie und Seelsorge einerseits und Psychologie und Therapie andererseits hat sich nicht so viel verändert, wie meine Kolleginnen und ich das noch vor 30 Jahren erhofft hatten. Die moderne Seelsorgebewegung wurde in den 80er Jahren zu einem Aufbruch, der auch manches verändert hat. Dennoch sind die Erkenntnisse und Verfahrensweisen meiner Erfahrung nach weit häufiger im medizinischen und psychotherapeutischen Bereich aufgegriffen worden, als im innerkirchlichen. Hier hätten wir mehr erreichen können. Ich sage das auch, weil der Dialog mit den medizinischen und pflegerischen Professionen genau darauf beruht, dass wir Theologen bereit und in der Lage sind, unser Verständnis vom Menschen zu erweitern und unser Methodenspektrum auszubauen. Das ist vielen von uns gelungen, aber viele andere verweigern sich dem nach wie vor. Mir war es immer wichtig, mit dem Begriff Pastoralpsychologie in meiner Arbeit diese Dimension wenigstens zu erinnern und für mich selbst wachzuhalten.
Um was genau geht es eigentlich im Spiritual Care und welche Debatten haben Sie hier in den letzten Jahren beobachten und begleiten können?
Spiritual Care ist ein sehr schillernder und vielschichtiger Begriff, der auch sehr unterschiedlich verwendet wird. Eine gewisse Einigkeit wurde erzielt, indem die meisten Insider inzwischen doch verstehen, dass wir damit die Begleitung von Menschen im Kontext von Krankheit und Sterben unter Wahrnehmung ihrer religiösen und geistigen Dimension verstehen. Etwas salopp ausgedrückt ist es der säkulare Begriff für das, was wir früher Krankenseelsorge genannt haben. Spiritual Care beruft sich auf die Definition der Weltgesundheitsorganisation, die Krankheit eben weiter fasst, als nur als organisches oder biochemisches oder neurologisches Ereignis. Der ganze Mensch ist mehr als sein Körper. Dem hat früher die Seelsorge Rechnung getragen. Heute ist diese Kompetenz und dieser Blickwinkel zum Glück nicht nur den Seelsorgerinnen und Seelsorger zu eigen, sondern er wird von anderen Professionen ebenfalls eingeübt. So ist Spiritual Care ein Begriff geworden, über den wir uns über Weltanschauungsgrenzen hinweg verständigen können. Ein gewisser Grad von Säkularisierung wird sich nicht aufhalten lassen und ist meines Erachtens auch gar nicht so tragisch. Viel wichtiger an den Bemühungen um Spiritual Care scheint mir, gewisse Einseitigkeiten in der Beschreibung und Behandlung des Menschen zu vermeiden. Wenn Sie so wollen, geht es um Ganzheitlichkeit, obwohl ich dieses Wort nicht so sehr schätze, weil es eigentlich nicht viel aussagt.
Welche Debatten und Themen sollten wir nicht aus den Augen verlieren?
Auch hier ist meine Antwort natürlich zunächst von der gegenwärtigen Gesundheitskrise, von der Pandemie durch Corona bestimmt. Ich befürchte eine allzu starke Hinwendung zur virtuellen Begegnung. Natürlich sind Zoom-Konferenzen und Online-Tagungsformate gegenwärtig ein nützliches Instrument, um überhaupt in Kontakt zu bleiben. Aber schon dieser Kontakt ist, bei aller technischer Raffinesse, äußerst rudimentär. Eigentlich ist es kein wirklicher Kontakt. Den Menschen als Körper, Geist und Seele, die Person als Leib mit Herz und Verstand zu erleben, kann nur gelingen, wenn auch leibliche Begegnung stattfindet. Diese ist durch nichts zu ersetzen. In der Medizinethik diskutieren wir über Telemedizin und Arztkontakte via Internet. In der Psychotherapie gibt es gute Ansätze für erfolgreiche Interventionen bei Jugendlichen mit Depression, die über einen Chat stattfinden. Die Telefonseelsorge ist ein uraltes und bewährtes Instrument. Doch in all diesen Bereichen wird stets betont, dass langfristiger therapeutischer Erfolg nur in der Behandlung und Begegnung von Angesicht zu Angesicht gelingt. Man kann das eine tun, darf das andere aber nicht lassen. Das geht übrigens über mein Themengebiet hinaus, weil es die gesamte Arbeit unserer Akademie und andere Bildungseinrichtungen betrifft. Die analoge Begegnung ist durch nichts zu ersetzen, sondern bestenfalls – und eigentlich nur in Ausnahmesituationen – digital und virtuell zu ergänzen.
Ein weiteres Thema wird die offenherzige Auseinandersetzung mit der Säkularisierung werden. Ich habe in der Medizinethik gelernt, dass Begegnung und Austausch und gemeinsames Handeln nur dann erfolgreich sind, wenn wir vorurteilsfrei und ohne missionarischen Eifer aufeinander zugehen. Ich lasse mir von keinem Philosophen oder keiner Ethikerin meinen Glauben infrage stellen oder mein Weltbild grundsätzlich verändern. Ich habe dies aber auch umgekehrt niemals versucht und nicht vor. Wir sind als Theologinnen und Seelsorger geschätzte Gesprächspartner für andere. Das habe ich immer wieder erfahren dürfen. Das genügt mir vollkommen. Dazu müssen wir aber ernst nehmen, dass es unterschiedliche Welt- und Menschenbilder gibt. Und diese alle müssen und werden in unserer Arbeit hoffentlich ihren Platz finden, selbst wenn sie nicht aus einem christlichen Deutungshorizont schöpfen. In solchem Dialog entstehen immer wieder spannende und neue Erkenntnisse.
Sie waren mit Leib und Seele Pfarrer und Studienleiter – nun sind Sie vor kurzer Zeit aus Ihrem Amt entpflichtet worden. Wie fühlt sich das an und auf was freuen Sie sich nun?
Zunächst fühle ich mich erleichtert. Der Akt der Entpflichtung ist ein sehr tiefgreifendes Ritual. So wie ich einst als Pfarrer ordiniert und auf diesen Dienst verpflichtet wurde, so bin ich nun von diesen Pflichten wieder befreit worden. Ich bin froh, dass wir solche Rituale haben und ernst nehmen. Ich bleibe ja Pfarrer mit meinen Rechten aus der Ordination und werde vielleicht in dem einen oder anderen Themenfeld noch weiterhin mitdenken und mitreden. Zunächst aber freue ich mich wirklich darauf, dass ein gewisses Maß an Freiheit möglich wird. Ein früherer Kollege aus der Akademie hat mir zum Abschied folgenden Satz von Jean-Jacques Rousseau mit auf den Weg gegeben: „Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will.“ Dem ist nichts hinzuzufügen. In Dankbarkeit für die Jahre an der Akademie und die vielen beruflichen Erfahrungen davor kann ich das jetzt auch gut ruhen lassen.
Die Fragen stellte Dorothea Grass.
Bild: Seit dem 1. Juli 2020 „Pfr.i.R.“: Frank Kittelberger im Schlosspark der Akademie. (Foto: dgr/eat archiv)