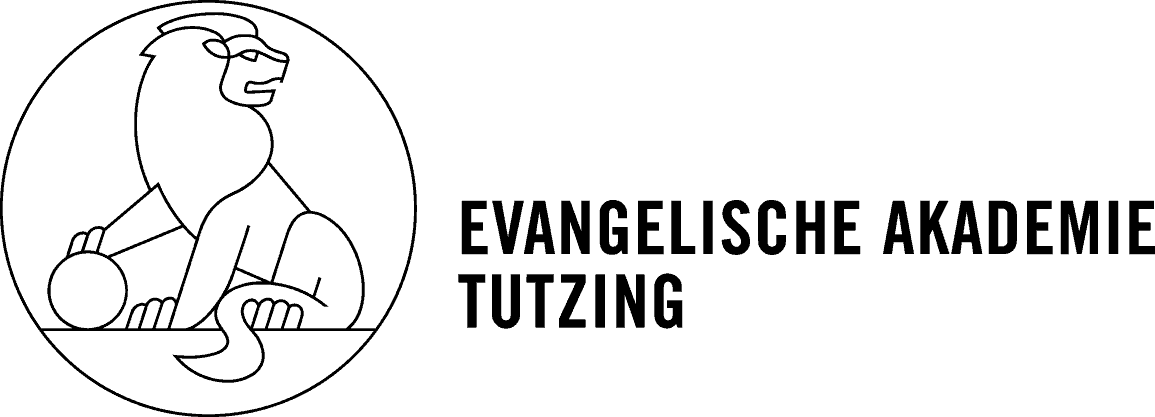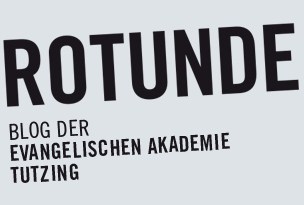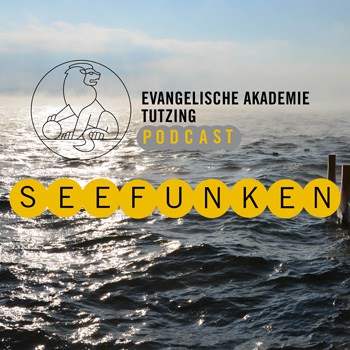Brot ist Kulturerbe – Aber welche Kultur(en) erben wir?
Brot ist Kulturgut – und es ist politisch. Wie Brot zum Steigbügel, Spielball und Spiegelbild politischer Interessen wurde, beleuchtet die Ökotrophologin Karin Bergmann anhand der Geschichte und dem Wandel der Zeit.
Von Karin Bergmann
Essen ist politisch. Das ist etwas Gewordenes – in langer Zeit. Seit jeher nutzten Herrscher und Machthaber opulente Bankette, um ihre Macht zu demonstrieren, diplomatische Beziehungen zu pflegen oder bestimmte Gruppen auszuschließen. Der deutsche Philosoph und Soziologe Georg Simmel (1858-1918) erkannte im gemeinsamen Essen ein verbindendes Element der Menschheit[1]. Studien belegen, dass gemeinsames Speisen Ängste reduziert, Aggressionen abbaut und eine vertrauensvolle Atmosphäre schafft. Lebensmittel sind ein Medium sozialer Interaktion – sie spiegeln Wertschätzung für andere, für sich selbst sowie für Natur und Kultur wider. Teilen Menschen dieselben kulinarischen Vorlieben, stärkt dies das Gemeinschaftsgefühl. Umgekehrt kann Essen auch als Mittel der Ausgrenzung und Bestrafung dienen – eine Praxis, die so alt ist wie die Menschheit selbst. Essen fungiert damit als Träger politischer Interessen.
Getreide als Kriegswaffe
Als Wladimir Putin im Februar 2022 die Ausfuhr ukrainischen Getreides blockierte, hatte dies gravierende Auswirkungen auf die weltweiten Lebensmittel- und Energiepreise. Besonders hart traf es die Staaten des afrikanischen Kontinents, die in eine ernste Ernährungskrise gerieten. In einem geopolitischen Kraftakt sahen sich Afrikas Staatschefs im Juli 2023 gezwungen, in St. Petersburg beim russischen Machthaber vorzusprechen. Ihnen gelang es, Putin ein Zugeständnis abzuringen: Moskau versprach, zwischen 25.000 und 50.000 Tonnen Getreide kostenlos an Burkina Faso, Simbabwe, Mali, Somalia, die Zentralafrikanische Republik und Eritrea zu liefern.
Doch hinter dieser Geste verbarg sich eine strategische Kalkulation. Der bevorstehende Russland-Afrika-Gipfel sollte dazu dienen, die politische Isolation Russlands zu durchbrechen. Putin nutzte die Gelegenheit, um mit afrikanischen Staatsvertretern über eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verhandeln. Das ukrainische Getreide war längst nicht mehr nur Kriegsbeute – es war zu einem machtvollen Verhandlungspfand in Putins geopolitischem Spiel geworden.
Brot als kondensierte Wertschätzung
An der Geschichte des Brotes lässt sich eindrucksvoll nachvollziehen, welche Wertschätzung ihm im Laufe der Jahrhunderte entgegengebracht wurde, wie sich diese wandelte und welche verdichteten kulturellen Werte sich in unserem heutigen Brotkonsum widerspiegeln.
Der Begriff Wertschätzung etablierte sich Mitte des 19. Jahrhunderts als Ausdruck der Anerkennung. Geschätzt wurde, was durch individuelles sittliches Urteil als erhaltenswert erachtet wurde. Doch bereits wenige Jahrzehnte später war der Begriff emotional aufgeladen und diente zunehmend als Instrument zur Mobilisierung gesellschaftlicher Stimmungen. Die Wertschätzung des Brotes war bald untrennbar mit der politischen Skandalisierung seiner Verschwendung verbunden. Sie mündete in moralische Tugenden wie Ehre, Würde und Pflicht.
Mussolinis Brot als ideologisches Werkzeug
Unter Benito Mussolini wurde Brot zum symbolischen Motiv eines nationalistischen Wertekanons. In hymnischer Manier beschwor er dessen zentrale Bedeutung für das Vaterland:
“Liebt das Brot – Das Herz des Hauses – Die Würze des Tisches (…) – Den Schweiß der Stirn – Den Stolz der Arbeit – Das Lob des Opfers – Ehrt das Brot – Den Ruhm der Felder – Den Geruch des Bodens – Das Fest des Lebens (…) – Reichtum des Vaterlandes – Das herrlichste Geschenk Gottes…”[2]
Diese ideologische Verklärung des Brotes diente als Vorgriff auf das, was sich wenig später in Deutschland vollziehen sollte: eine propagandistische Überhöhung der Brotkultur als Bestandteil nationalistischer Identitätsbildung.
Kriegsvorbereitungen, Propaganda und Hungerjahre
In der Zeit des Nationalsozialismus wurde die Bekämpfung des Brotverderbs politisch verordnet – eine Maßnahme, die nicht nur als Zeichen wirtschaftlicher Sparsamkeit galt, sondern auch in die umfassenden Kriegsvorbereitungen eingebettet war. Die nationalsozialistische Ideologie verband die Wertschätzung des Brotes mit moralischen Appellen und rassenideologischen Narrativen. Parolen wie “Brot, dem deutschen Boden abgerungen”, “Das kostbarste Volksgut”, “Ein Stück Brot – Schämst du dich nicht?” oder “Geschändetes Brot – geschändete Ehre!” [3]verknüpften die tägliche Nahrungsaufnahme mit Fragen nationaler Identität, Wehrhaftigkeit und Kriegsbereitschaft. Die propagandistische Verherrlichung des vollen Korns diente nicht zuletzt der Mobilisierung für den Krieg.
Doch die nationalistische Brotpolitik endete in unermesslichem Leid. Der Zweite Weltkrieg brachte Hunger, Mangelernährung und Hungertod. Die Not des fehlenden Brotes hinterließ tiefe Spuren in den Generationen der Kriegs- und Nachkriegszeit – als schmerzliche Verkörperung von Entbehrung, Not und letztlich dem Gnadenbrot einer zerstörten Gesellschaft.
Brot als Kulturerbe – Die Freiheit des Wandels
Brot ist über Jahrhunderte hinweg ein Symbol der Verwandlung geblieben – sowohl in kulinarischer als auch in kultureller Hinsicht. Der Begriff Kultur ist dabei wertneutral: Er umfasst sowohl positive als auch negative Konnotationen. Unser heutiges Brotkulturerbe kann nicht ohne das Bewusstsein für seine historische Instrumentalisierung durch Diktaturen betrachtet werden.
Doch welch ein Privileg: Heute können wir Brot in Freiheit genießen, ohne ideologische Dogmen oder politische Vereinnahmung. Die Zeiten haben sich gewandelt und lassen uns auf die Marmeladenseite der Brotscheiben blicken. Gleichwohl bleibt die Wertschätzung von Brot untrennbar mit ethischen Fragen zu Konsum, Produktion, Umwelt, Ökonomie und Gesundheit verbunden. In einer modernen Gesellschaft bedeutet Wertschätzung von Lebensmitteln nicht nur deren sorgsamen Umgang, sondern auch Achtung gegenüber den Menschen, die sie anbauen, verarbeiten und vertreiben.
Heute dürfen wir Brotkultur schätzen, ohne die Traditionen anderer zu diskreditieren. Erstmals in der Menschheitsgeschichte kann Genuss der zentrale Aspekt der Wertschätzung sein. Gleichzeitig bleibt Brot ein Medium der Dankbarkeit, Spiritualität und Religiosität. Dies verdeutlichte Kirsten Fehrs, die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, in ihrer Predigt zum Erntedankfest 2024:
“Danke für all Ihr Tun, um diese Schönheit zu hegen und zu pflegen und aus dem, was Gott uns als Lebensgrundlage geschenkt hat, tatsächlich Lebensmittel, Überlebensmittel für uns alle zu machen. Was für eine Mühe, wie viel Erfahrung, wie viel Fleiß und Können stecken in all dem, was wir hier am Altar, auf den Märkten sehen, riechen und schmecken können. Von Ihnen gesät, angebaut, begossen, geerntet, gekocht, gebacken.”[4]
Nie waren die Möglichkeiten größer, Brot in all seiner kulturellen Vielfalt zu genießen – und sich zugleich der jederzeit wieder möglichen politischen Vereinnahmung bewusst zu bleiben.
Über die Autorin:
Dr. Karin Bergmann ist Ökotrophologin sowie Gründerin und Geschäftsinhaberin von Dr. Bergmann Food Relations®. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Deutschen Brotinstitutes an der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim.
Hinweis:
Mit dem Thema Brot beschäftigen wir uns ausführlich vom 2.5.- 4.5.2025. während der Tagung “Unser täglich Brot”. Dr. Karin Bergmann gehört sowohl als Expertin als auch als Vorstandsmitglied des Freundeskreises der Evangelischen Akademie Tutzing e.V. zum Leitungsteam der Tagung. Sie wird zu den Themen “Nachhaltigkeit zum Essen – Getreide und Brot im Spiegel von Gesundheit und Umwelt” sowie gemeinsam mit Prof. Dr. Christine Brombach zu “Brot und Dankbarkeit” referieren. Alle Informationen zur Tagung finden Sie hier.
Literaturnachweise:
[1] Barlösius, 1999; Simmel, 1910 Abhandlung Soziologie der Mahlzeit von 1910
[2] Velberter Zeitung 1933, Nr. 157 v. 11. Juni, 9: Zitiert in Dr. Uwe Spiekermann: Ehret das Brot! Wirtschaftlichkeit, Wertschätzung und Wehrbereitschaft 1925-1945 https://uwe-spiekermann.com/2025/03/12/ehret-das-brot-wirtschaftlichkeit-wertschatzung-und-wehrbereitschaft-1925-1945/
[3] Ebd.
[4] https://www.ekd.de/fehrs-zum-erntedankfest-2024-85923.htm
Bild: Karin Bergmann