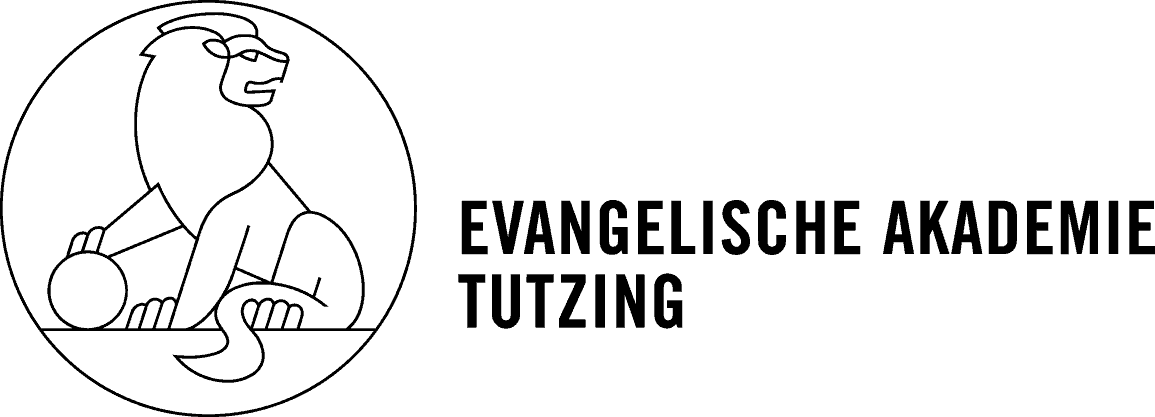Bildung und Begegnung
Die Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor sieht darin ein probates Mittel, muslimischen Antisemitismus zurückzudrängen.
Der Antisemitismus in Deutschland wächst. Auch unter Muslimen sind anti-jüdische Einstellungen anzutreffen. Worin liegen die Ursprünge und Besonderheiten? Und wie kann ihnen begegnet werden? Darum ging es in einem Podiumsgespräch, zu dem die Evangelische Akademie Tutzing am 14. März eingeladen hatte. Damit beteiligte sie sich an den Internationalen Wochen gegen Rassismus, die die Landeshauptstadt München aktuell veranstaltet. In seiner Begrüßung erinnerte Akademiedirektor Udo Hahn daran, dass es zum Auftrag der Bildungseinrichtung gehöre, sich gegen Rassismus und Antisemitismus einzusetzen. Dafür müsse man Ursachen kennen und Zusammenhänge verstehen. Antisemitismus sei ein vielschichtiges Problem, das gleichermaßen Politik, Gesellschaft und die Kirchen herausfordere.
Benjamin Idriz, Imam der islamischen Gemeinde Penzberg, der neben der Islamwissenschaftlerin und muslimischen Religionspädagogin Lamya Kaddor, als Podiumsgast eingeladen war, unterstrich, dass man die Probleme schonungslos benennen müsse. Er habe aus diesem Grund im September 2017 in seiner Gemeinde eine Predigt gehalten, in der er auf das Problem einging. Ihr Titel lautete: „Moses lieben und Juden hassen?“ Darin sagte er: „Wir müssen uns eingestehen, dass es nicht nur an den Rändern unserer Gemeinschaft, sondern auch und gerade in ihrer Mitte, viel zu häufig eine tiefe Verachtung gegenüber dem Anderen, dem Fremden – in diesem Fall gegen Juden gibt. Es gibt unter uns einen Hass, den wir viel zu häufig relativieren oder vermeintlich sachlich zu begründen suchen. Weltgeschichtliche Ungerechtigkeit, Kriege und Besatzungen dienen uns dazu, diese Verachtung und diesen Hass lebendig zu halten. Oftmals sind es Vorurteile darüber, wie Juden leben, welche negativen Eigenschaften sie in unserer Vorstellung haben. Mit einer solchen Vorstellung befinden wir uns aber bereits mitten in einer Gedankenwelt, in der kein Platz mehr bleibt für die individuelle Begegnung mit Christen und Juden. Das ist eine Gedankenwelt, in der Juden nicht mehr als unterschiedliche Menschen, als Individuen mit persönlichen Stärken und Schwächen wahrgenommen werden, sondern in denen „die Juden“ nur mehr als kollektive Schablonen herhalten, mit denen wir ganze Gemeinschaften negativ markieren.“
Idriz verwies auf historische Beispiele einer friedlichen Koexistenz von Juden und Muslimen – etwa in Andalusien und Bosnien. Auch heute gebe es viele positive Beispiele. Ressentiments, so Idriz, entstünden vor allem aus politisch motivierten Konflikten sowie aus Unwissen – über die eigene Religion, die des jeweils anderen, Geschichte und Kultur.
Vertrauen wiederherstellen
Dieser Punkt spiegelte auch die Erfahrungen Lamya Kaddors. Sie sei zu dem Schluss gekommen, dass es vor allem nötig sei, an der Bildung anzusetzen. „Mit einer Predigt kann man Antisemitismus nicht bekämpfen“, so Kaddor. Sie plädiert u.a. für eine Erweiterung der Lehrpläne an den Schulen.
Schulklassen in Deutschland seien in ihrer Zusammensetzung heterogener geworden, was sich aus der Tatsache ergebe, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei. Auch wenn darüber nach wie vor gestritten werde, habe sie es erlebt, wie es ist, vor Schulklassen zu stehen, in denen Kinder aus Familien kämen, die keinen Bezug zur deutschen Geschichte, keine familiären Berührungspunkte mit Erfahrungen aus dem beiden Weltkriegen hätten. Vor allem der Geschichtsunterricht müsse die unterschiedlichen Erfahrungs- und Kulturwelten, aus denen die Kinder kommen, mit bedenken. Sie fordert dazu auf, den „Eurozentrismus“ in der Geschichtsvermittlung zu überwinden. Ein weiterer Punkt sei „Empathievermittlung“. Schüler müssten Geschichte auch „emotional begreifen“ lernen. Persönliche Kontakte mit denen, über die man nichts wisse, seien hilfreich.
Kaddor berichtete darüber hinaus von einer Art „Opferkonkurrenz“, die ihr im Zusammenhang mit Antisemitismus begegne. „Auch Opfer können andere ausgrenzen.“ Und oft geschehe das aus dem Grund, weil der Ausgrenzende sich durch das eigene Leid dazu im Recht sehe, andere ebenfalls auszugrenzen. Dieser Haltung tritt sie entschieden entgegen.
Wichtig sei, so Imam Idriz, das Vertrauen zwischen beiden Religionen wieder herzustellen, das durch politische Interessenskonflikte kaputt gegangen sei. Es gebe viele gemeinsame Traditionen zwischen Muslimen und Juden. Diese gelte in den Vordergrund zu stellen, genauso wie positive Beispiele eines gelungenen Zusammenlebens und die Tugend der Nachsicht mit dem jeweils anderen. Egal ob Christen, Juden oder Muslime, so Idriz: „Wir sind die Nachkommen von Brüdern, Verwandte einer gemeinsamen Offenbarung.“
dgr
Bild oben: Udo Hahn, Lamya Kaddor und Imam Benjamin Idriz im Foyer vor dem Auditorium der Evangelischen Akademie Tutzing. (Foto: dgr/eat archiv)