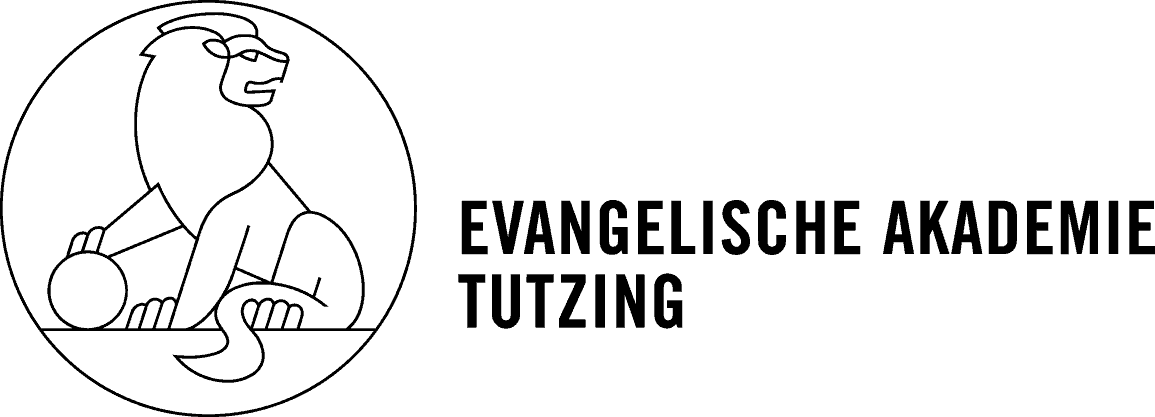Grußwort Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm
Es gilt das gesprochene Wort!
Jahresempfang der Evangelischen Akademie Tutzing, 17.1.2019
Grußwort Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
Meine Damen und Herren,
ich vermute bei allem großen Respekt für die Arbeit der Evangelischen Akademie Tutzing, nicht, dass Herr Hahn und alle für die Planung dieses Jahresempfangs Verantwortlichen über hellseherische Fähigkeiten verfügen. Man könnte allerdings schon auf diese Idee kommen, wenn man das Thema dieses Empfanges und die Wahl des heutigen Gastes mit den aktuellen Entwicklungen dieser Tage verknüpft. Denn es hat selten Zeiten gegeben, an denen das Thema Europa die Politik, die Öffentlichkeit und uns alle so sehr beschäftigt hat wie in diesen Tagen. Die Dramatik der Ereignisse hat historischen Charakter. Die Möglichkeit, dass ein Land vom politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Format Großbritanniens nicht nur die Europäische Union verlässt, sondern es auch auf eine Weise verlässt, die im eigenen Land Chaos und im übrigen Europa Sorge, Ratlosigkeit hinterlässt und dort womöglich in heimliche oder offene Schadenfreude mündet, wenn die destruktiven Konsequenzen sichtbar werden, ist eine düstere Aussicht. Alles, was nach zwei Weltkriegen an Zusammenhalt zwischen den Völkern Europas entstanden ist und die Möglichkeit von neuen tiefen Konflikten der alten Feinde einfach undenkbar gemacht hat, scheint in Gefahr zu geraten.
Es geht also um viel. Und überall, wo in den nächsten Monaten die anti-europäischen Stimmen in Großbritannien ein anti-britisches Echo auf dem Kontinent hervorrufen mögen, das sage ich schon jetzt, ist entschiedener Widerspruch angesagt. Die klare Botschaft an die Briten muss jetzt erst recht sein: Wir wollen auf Euch als ein zentrales Stück Europa nicht verzichten. Sowieso nicht, wenn es um die gemeinsamen Werte und die historisch gewachsene gemeinsame Kultur geht. Aber auch nicht, wenn es um die institutionellen Zusammenhänge geht, die diesen gemeinsamen Werten eine äußere Stütze geben und unverzichtbar sind, wenn es um die Bewältigung der großen Herausforderungen für die Zukunft heute geht.
Ich bin davon überzeugt, dass sich die Verantwortung für das Friedensprojekt Europa gerade auch den Kirchen stellt. Als Kirchen stehen wir für die radikale Liebe Jesu Christi, die allen Menschen gilt und die alle nationalen und kulturellen Grenzen sprengt. Ich möchte, dass wir nie wieder Waffen segnen, mit denen sich ganze Völker gegenseitig umbringen. Wir sind gerufen, überall da, wo Hass geschürt wird oder Nationalismus die Herzen der Menschen vergiftet, die große Liebeserklärung Gottes, die sich in dem Menschen Jesus Christus gezeigt hat, selbst auszustrahlen. Wir sind gerufen, für Solidarität und Kooperation über nationale Grenzen hinweg einzutreten, für die Versöhnung gerade zwischen Völkern, die eine lange und traurige Geschichte von Krieg und Gewalt hinter sich haben.
Als Kirchen sind wir Teil eines einmaligen internationalen ökumenischen Netzwerks, deren Glieder sich, wenn sie sich begegnen, als „liebe Schwestern und Brüder“ ansprechen. Wo ich diese Anrede wähle, wenn ich zu Besuch bei einer unserer Partnerkirchen bin und dort predigen darf, ist das keine Floskel, sondern tief gefühlt und theologisch genau überlegt. Wie könnten wir in den Chor der nationalistischen Scharfmacher, auf welcher Seite auch immer, einstimmen, ohne den Herrn zu verraten, der die Grundlage für diese Geschwisterlichkeit ist!?
Mitte November habe ich zwei Tage in Lambeth Palace beim Erzbischof von Canterbury verbracht. Am zweiten Tag veranstalteten wir eine Konferenz zum Brexit, während genau gegenüber auf der anderen Seite der Themse, nach der Bekanntgabe des Brexit-Deals die Minister zurücktraten. Gemeinsam mit Erzbischof Justin haben wir damals eine Erklärung veröffentlicht, aus der ich einige Sätze zitieren möchte:
„Als Spitzen unserer Kirchen sind wir miteinander verbunden im Bekenntnis um ein starkes Europa, das dem gemeinsamen Wohl und dem Respekt gegenüber der Würde aller Menschen dient, der Würde der Gläubigen und aller anderen Menschen. Als Geschöpfe Gottes und als Empfänger der Liebe, die sich in Jesus Christus offenbart, appellieren wir an unsere Regierungen, nicht die dringende Aufgabe aus den Augen zu verlieren, die uns gegebene Welt und ihre Menschen zu schützen. Unsere Welt verdient eine bessere Zukunft als die von Hass und Spaltung. Es ist Aufgabe der Kirche, über alle Grenzen hinweg Zeugnis von der Liebe Gottes abzulegen – als Schwestern und Brüder in Jesus Christus.“
Die Vision eines Europas des Friedens, der Solidarität und der Gerechtigkeit teilen wir als Kirchen mit allen Menschen guten Willens. Wir wenden uns gegen den Missbrauch des Heimatbegriffes für Ideologien, die ihre eigene Identität dadurch stärken wollen, dass sie andere abwerten. Einen ganz anderen Heimatbegriff hat ein Mann schon vor langer Zeit in den Blick genommen, der einer der Vordenker eines gemeinsamen Europas war viel und zu früh verstorben ist.
Der ehemalige tschechische Präsident Vaclav Havel hat am 24. April 1997 im Deutschen Bundestag eine historische Rede gehalten, in deren Mittelpunkt eine Neuauslegung des Begriffs der „Heimat“ für das zukünftige Zusammenleben in Europa stand. Kennzeichnend für diese Rede war das Plädoyer für eine Verbindung von Pluralismus und universaler Offenheit einerseits und einer klaren Wertebindung andererseits als Charakteristikum einer gesellschaftlichen Gemeinschaft.
Von seinem Ursprung her – so Havel – bezeichnet das Wort Heimat keine abgeschlossene Struktur, sondern das Gegenteil davon: „eine Struktur, die öffnet – eine Brücke zwischen dem Menschen und dem Weltall; ein Leitfaden, der vom Bekannten auf das Unbekannte, vom Sichtbaren auf das Unsichtbare, vom Verständlichen auf das Geheimnisvolle, vom Konkreten auf das Allgemeine weist. Es ist der feste Boden unter den Füßen, auf dem der Mensch steht, wenn er sich zum Himmel hin ausrichtet.“[1] Havel wendet sich von daher dagegen, „dass Heimat eher als ein ungelüftetes Loch statt als Sprungbrett der menschlichen Entfaltung betrachtet wird; eher als eine Höhle, die den Menschen vor der Welt schützt, statt als Raum für seinen Kontakt mit ihr; eher als ein Instrument der Isolierung des Menschen von den anderen statt als ein Tor, das ihm den Weg zu den anderen öffnet.“
Sein eigenes Verständnis von Heimat entwirft Havel explizit von einem bestimmten Verständnis von Freiheit her: „Freiheit im tiefsten Sinne des Wortes bedeutet mehr […] als ohne Rückhalt zu sagen, was ich denke. Freiheit bedeutet auch, dass ich den anderen sehe, mich in seine Lage hineinzuversetzen, in seine Erfahrungen hineinzufühlen und in seine Seele hineinzuschauen vermag und imstande bin, durch einfühlsames Begreifen von alledem meine Freiheit auszuweiten. Denn was ist das gegenseitige Verständnis anderes als die Ausweitung der Freiheit und die Vertiefung der Wahrheit?“
Europa – sagte Havel – „sollte viel deutlicher zur Heimat unserer gemeinsamen Werte werden, so wie sie aus unseren besten geistigen Traditionen und den erworbenen geschichtlichen Erfahrungen erwachsen. Wir alle wissen, um welche Werte es geht: Respekt für die Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Bürgergesellschaft, Marktwirtschaft, Sinn für soziale Gerechtigkeit, Achtung vor der Natur und vor unserer Umwelt.“
Die Vision von Europa, die Havel hier entwirft, könnte nicht aktueller sein. Gerade jetzt gilt es, für sie einzutreten. Morgen wird eine große Anzeige in der britischen Times erscheinen, die um die Briten und ihre Einbindung in Europa werben wird. Sie ist von deutschen Politikern initiiert, wird aber von verschiedenen Vertretern aus der Mitte der deutschen Gesellschaft mitunterzeichnet sein. Auch ich habe mich zur Unterzeichnung entschlossen. Meine Hoffnung ist, dass diese Anzeige diejenigen in Großbritannien stärkt, die die Vision Vaclav Havels teilen.
Auch unser heutiger Redner, Jean Asselborn, steht, wie kaum ein anderer, für diese Vision. Deswegen ist es eine Freude und Ehre für uns, ihn heute zu Gast zu haben. Und wir freuen uns auf seinen Vortrag.
Vielen Dank!
[1] Die Rede ist abgedruckt in der Frankfurter Rundschau, 25.4. 1997, S.10