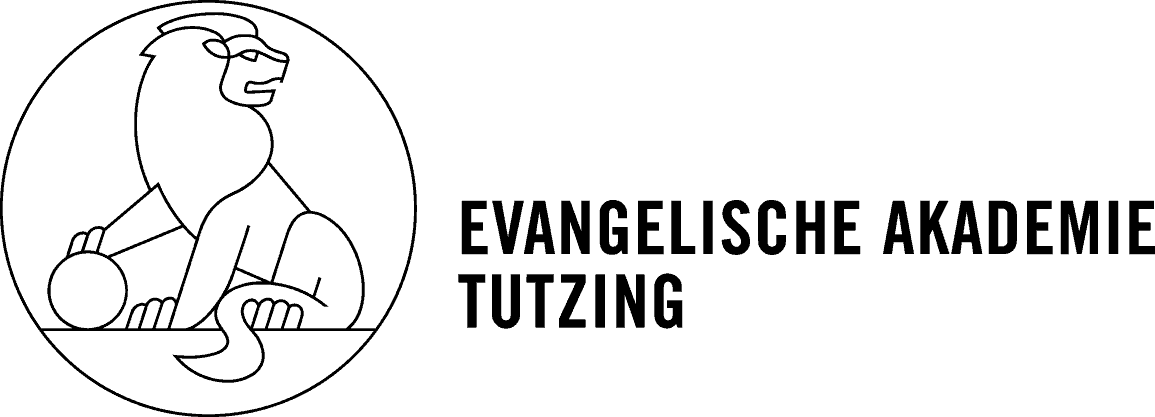1966 / 2016 Rendezvous oder Deja-vu?
1966? Was hat die Menschen bewegt? England wurde Fußballweltmeister gegen Deutschland. Die Große Koalition, Atomkriegsgefahr, erste APO-Impulse, Mini-Cooper und Minirock, die Beatles im Circus Krone, Roling Stones und Jimi Hendrix.
Und 2016, ein halbes Jahrhundert später? Der Flow eines leichten Lebens, Emanzipation, Individualität, Konsumglück und Konsumgroll, Hightech und Retromania, Ökokollaps, Terror und Religion.
In Zusammenarbeit mit dem Brigitte Grande, der Vorsitzenden des Freundeskreises der Akademie, hatte Studienleiter Dr. Jochen Wagner Alt und Jung, Träumer wie Furchtlose, Wissende wie Suchende in das Schloss Tutzing zu einem Gedankenaustausch eingeladen.
Ein Bericht von Thomas Lochte:
Es geht immer nur um dieses Tor, das keines war: Befragt man heute Zeitzeugen von 1966, was ihnen aus jenem Jahr im Gedächtnis haften geblieben ist, fällt ihnen zumeist das berühmt-berüchtigte 3:2 aus dem WM-Finale von Wembley ein, das England den Weg zum Titel bahnte und die Deutschen in eine zumindest fußballerische Depression stürzte. Unter der Überschrift „1966 / 2016 – Rendezvous oder Déjà-vu?“ beschäftigte sich ein dreitägiges Symposium der Evangelischen Akademie Tutzing mit der Frage, ob es vor genau 50 Jahren noch andere fortwirkende Ereignisse gab, ob sich ein Bogen ins Jahr 2016 würde schlagen lassen oder ob die Brüche gegenüber „´66“ inzwischen überwiegen.
Studienleiter Dr. Jochen Wagner und die Vorsitzende des Freundeskreises der Evangelischen Akademie, Brigitte Grande, hatten das durchaus abendfüllende Thema wohltuend portioniert und den Blick auf 50 Jahre zeitgeschichtlichen Wandel von verschiedenen Seiten aufs Sujet gerichtet – die entsprechenden, fast durchweg gut besuchten Veranstaltungen vom 25. bis 27. November trugen die Titel: „Von der Politik“, „Von der Industrie“, „Von der Natur“, „Vom Sport“, „Vom Lebensstil“, „Von Beziehung, Familie und Beruf“, „Von den Schönen Künsten“, „Von der Mobilität“, „Von der Musik“, „Von der Psycholo-gie“, „Von der Wissenschaft“, „Von der Kunst“, „Von der Religion“ und „Von Vorbildern“.
Von Letzteren, also den potenziellen „Vorbildern“, hatte die Akademie sogar ein paar als Tagungsgäste eingeladen, doch der 81-jährige Hans Tilkowski (WM-Torwart von 1966) musste aus gesundheitlichen Gründen ebenso absagen wie der einst als „fünfter Beatle“ apostrophierte Klaus Voormann und der wissenschaftliche Welterklärer Prof. Dr. Harald Lesch – so nutzte allerdings der Nachwuchs seine Chance und verschob die Akzente ein Stück weit weg von 1966 in Richtung 2016 ff. – etwa beim Teilaspekt „Politik“: Johannes Kahlaus, Doktorand an der Uni Hamburg mit Tutzinger Wurzeln, hatte für die bundesdeutsche Gegenwart zum einen „eine autoritäre Form von Staatlichkeit“ diagnostiziert, zum andern mit Blick auf Europa „eine sich formierende nationalistische Internationale“. Es herrsche gegenwärtig, so die ernüchternde Bestandsaufnahme Kahlaus, „ein Dogma der technokratischen Machbarkeit, der Alternativlosigkeit“. 30 Jahre Neoliberalismus hätten „ihre Spuren hinterlassen“, eben das Ende aller Utopien.
Prof. Dr. Marcus Llanque (Universität Augsburg), Jahrgang 1964, leitete sein Statement mit der humorvollen Bemerkung ein, es sei selber „das Produkt“ einer gelebten Utopie – nämlich eines Südamerikaners und einer Deutschen. Über die wohl ähnlich unübersichtliche Gemengelage des Jahres 1966 hatte der Sozialwissenschaftler herausgefunden: „Ein Wir in dem Sinn gab es damals nicht.“ Moderator Jochen Wagner ergänzte: „´66 war noch nicht ´67!“ Llanque empfahl als erhellende Lektüre eine damalige Artikelfolge des Philosophen und bekennenden Max-Weber-Schülers Karl Jaspers im SPIEGEL, die später zum Buch „Wohin treibt die BRD?“ gerann: „Er begann damals mit Graf Stauffenberg!“, merkte Llanke an, es ging Jaspers in seiner Analyse darum, wie der Mensch durch „Obrigkeitsmentalität und Untertanengeist zum Spielball politischer Mächte“ werden konnte und womöglich abermals werden würde. Da es um „Hoffnungen und Visionen“ jener Zeit ging, durfte natürlich auch das oft bemühte Helmut-Schmidt-Zitat nicht fehlen: „Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.“ Bei Llanque war´s zitierender Weise der Augenarzt. Jochen Wagner (Jahrgang ´57) erzählte davon, dass die Jugendzeitschrift „BRAVO“ bei ihm daheim „verboten“ gewesen sei – immerhin: Bei einem Freund hingen Starschnitte von Winnetou und Brigitte Bardot neben der Tischtennisplatte an der Kellerwand… Die damals etwas älteren Jahrgänge, also die studierfähigen „Semester“, waren 1966 offenbar noch nicht erfasst von der Wucht des Protests, den der Vietnam-Krieg, der Schah-Besuch ab 1967 auch in Deutschland auslösen sollte.
Parallelen und Ähnlichkeiten zwischen 1966 und 2016 – in beiden Jahren regierte eine „Große Koalition“ – sie ließen sich nicht so recht herausarbeiten, eher Kontraste: Der Revoltismus von einst sei „in Veralltäglichung übergegangen“, so Llanque. Letztlich muss er wohl abgeebbt sein, weil auch theoretisierende Strudenten ja irgendwann Miete zahlen und sich den Problemen der eigenen Existenzsicherung stellen mussten; Johannes Kahlau, Student von heute, dürfte wie seine ganze Generation vor dem gleichen Problem stehen – doch wegen explodierender Mieten geht 2016 bislang noch kaum einer auf die Straße.
„Vom Sport“ gab es dann ein zu 100 Prozent dem Fußball gewidmetes „Rendezvous“ zu berichten – beim stark ballorientierten Tagungsleiter Jochen Wagner kein Wunder: Statt Hans Tilkowski war Florian Hinterberger nach Tutzing gekommen, der als aktiver Fußballprofi (zuletzt Bayer Leverkusen) und späterer Sportdirektor des TSV 1860 München die rasante Entfremdung seiner Sportart vom „Elf-Freunde“-Prinzip zur Totalkommerzialisierung quasi am eigenen Leib miterlebt hatte: „Es war zu meiner Zeit anfangs gar kein Gedanke daran, zielgerichtet auf den Beruf des Fußballprofis zuzugehen“, so Hinterberger, „heute muss es einer schon mit etwa zehn Jahren in eines dieser Leistungszentren schaffen, um eine Chance zu haben.“ Und von diesen „Auserwählten“ würde es dann auch nur zehn Prozent gelingen, es zum Berufskicker zu bringen. Wagners jüngerer Sohn Raphael beantwortete auf dem Podium die Frage eines Tagungsteilnehmers entsprechend „professionell“: Ob er denn lieber mit seinen Freunden in der Altersleistungsgruppe „D 2“ spielen möchte oder in der „D 1“-Elite?, wurde der etwa Zwölfjährige gefragt – die Antwort fiel zu Gunsten der möglichen Karriere aus.
Hinterberger war in seiner eigenen Jugendzeit noch aufgefallen, „dass die Schlechtesten oft den besten Ball hatten“ – ergo habe man sie mitspielen lassen müssen. Die hohe Selektivität im heutigen Fußball, so der 57-Jährige, führe aber dazu, dass die Eltern dem Ziel, einen möglichen künftigen Profi in der Familie zu haben, fast alles unterordneten und ihre Kids „fünf Mal die Woche zum Training bzw. Spiel“ kutschierten. Ein Uwe Seeler hatte als angehender Star solchen „Service“ noch nicht – er fuhr bestenfalls mit dem Fahrrad zum Training seiner HSV-Jugend. Bis heute stehe der inzwischen 80-jährige „Uwe“, der einst ein fürstliches Angebot von Inter Mailand abgelehnt hatte und bodenständig in Hamburg geblieben war, für bestimmte Werte, die so gänzlich anders erscheinen als die Prioritäten des Jahres 2016, bestätigte Hinterberger. Da kommt es im neo-darwinistischen Zeialter schon mal vor, dass ein Jugend-Trainer bei den „D 3“-Jugendlichen ungeniert von „Ausschuss“ spricht. Und wenn von „Träumen und Visionen“ die Rede ist, kommt einem unweigerlich der TSV 1860 München und sein ewiger Mythos vom „Arbeiterklassenfußball“ in den Sinn: „Bei keinem Verein klaffen Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander wie bei diesem“, seufzte Hinterberger, während Jochen Wagner dazu ein kaum vernehmbares „1. FC Nürnberg“ dazu murmelte.
„Von der Wissenschaft“ hätte eigentlich der mediengewandte Prof. Dr. Harald Lesch auf dem Podium berichten sollen, doch nach dessen kurzfristiger Absage kam auch hier die studierende Jugend und damit die „wissenschaftspraktische“ Realität des Jahres 2016 verstärkt zum Zuge: Sie sei zwar als Studierende anfänglich „faustisch suchend unterwegs“ gewesen, berichtete die Studentin der Kultur- und Sozialanthropologie an der Uni Wien, Diana Michaelis, doch dann habe sie u.a. anlässlich einer Studienreise in den Oman feststellen müssen, „dass Wissenschaft nur noch eine Denkweise von vielen anderen“ darstelle – die womöglich schmerzliche Erfahrung einer Relativierung des individuellen Forschungsdrangs also? Forschendes Denken verhindere womöglich gar ein interkulturelles Verständnis, ging Michaelis noch einen Schritt weiter und bekannte, eine „persönliche Krise“ beim Studieren gehabt zu haben. Ihr Vorschlag war, „Wissen“ besser miteinander als übereinander zu generieren – die heutige Komplexität der Welt sei durch das „Tool Wissenschaft“ ohnehin nicht mehr darstellbar. Prompt kam aus Kreisen der Tagungsteilnehmer die Replik, heutzutage kranke Vieles daran, „dass es keine Studierenden mehr gebe, die es aushalten, die Dinge im Ungefähren zu lassen“ – Moderator Jochen Wagner brachte an dieser Stelle den Begriff von der „Poesie des Augenblicks“ an, der dem wissenschaftlichen Anspruch auf Messbarkeit und Eindeutigkeit noch immer entgegen stehe. „Zu meiner Zeit war das Wesensmerkmal der Wissenschaft der fortwährende Zweifel“, so ein älterer Diskutant. Ein anderer erinnerte beim Bogenschlag von 1966 zu 2016 daran, dass man sich 1966 „im wissenschaftlichen Elfenbeinturm bewegt habe – heute hingegen seien alle Forschungsergebnisse mitunter „binnen Minuten weltweit verfügbar“. Und ein Dritter: „Keine Physik ohne Metaphysik – und umgekehrt!“
Fazit dieses Tagungsabschnitts war eine gewisse Irritation, die offensichtlich vom Verlust des Sinnlichen auf der Suche nach dem Faktischen ausgelöst wird. Schlusswort Jochen Wagner in eigener Sache: „Ich war und bin bis heute in meinen Träumen lebendig – me nutrit, me destruit“ (Es nährt mich, es zerstört mich). Dann noch ein Zitat von Walter Benjamin: Träume im Sinne von Trost seien „Komfort in einer Eiswüste von Kosmos“. Und wieder Wagner, an die Adresse der Wissenschaftler ebenso wie an die neuen Apologeten des „Postfaktischen“ gerichtet: „Ordnung und Unordnung – beide machen mir Angst.“
Ein Tagungsteilnehmer merkte hinterher kritisch an, ihm sei das etwas ein bisschen zu viel des „Unwissenschaftlichen“. So war es zwischen „1966“ und „2016“ auch eher ein unverbindliches Rendezvous, mit den dominanten Anekdoten der älteren Generation aber auch ein „Déjà-vu“… Thomas Lochte

Johannes Kahlau, Doktorand an der Uni Hamburg, stellte fest es herrsche gegenwärtig – so seine ernüchternde Bestandsaufnahme -, „ein Dogma der technokratischen Machbarkeit, der Alternativlosigkeit“. 30 Jahre Neoliberalismus hätten „ihre Spuren hinterlassen“, eben das Ende aller Utopien.

Prof. Dr. Marcus Llanque (Universität Augsburg), hatte über die wohl ähnlich unübersichtliche Gemengelage des Jahres 1966 herausgefunden: „Ein Wir in dem Sinn gab es damals nicht.“
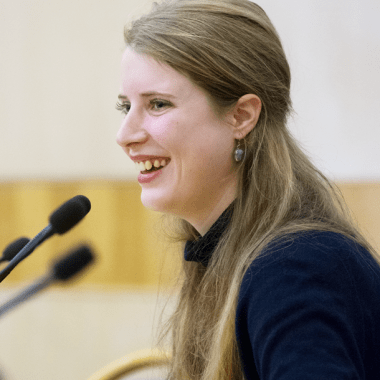
Diana Michaelis, Studentin der Kultur- und Sozialanthropologie an der Uni Wien, gelangte zu dem Resultat, „dass Wissenschaft nur noch eine Denkweise von vielen anderen“ darstelle.