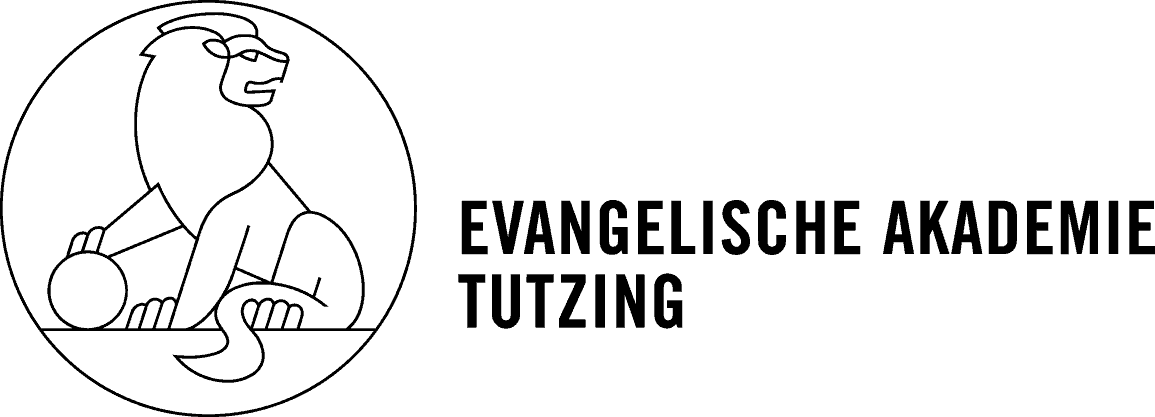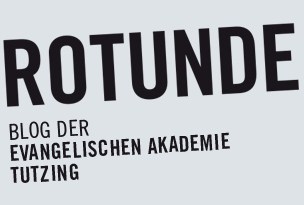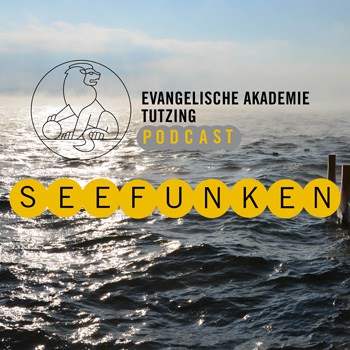Leere Worte
Warum erweisen sich bisher alle Versprechen, einen bestimmten Geldbetrag zur Finanzierung der Transformation aufzubringen, als leere Worte? Lesen Sie in diesem Gastbeitrag der Volkswirtschaftler Ulrich Klüh und Richard Sturn, warum die “Finanzierung” der Nachhaltigkeitstransformation ein politisches Problem ist.
Von Ulrich Klüh und Richard Sturn
(Eine Langversion des Artikels mit Schaubildern als PDF ist hier abrufbar.)
Die aktuelle politische Lage in Deutschland führt uns eindrucksvoll vor Augen: Die ökologischen, geopolitischen, sozio-ökonomischen und digitalen Krisen unserer Zeit sind vor allem auch Krisen der “Finanzierung”: Die Ampelkoalition scheiterte nicht zuletzt an unterschiedlichen Auffassungen zur Finanzierung der Ukrainehilfe und der Klimapolitik. Die Wahlprogramme bestimmter Parteien übertreffen sich in Steuersenkungen, die nach Meinung der anderen Parteien stark „unterfinanziert“ sind. Olaf Scholz setzt auf einen „Deutschlandfonds“, den „Investitionsturbo“, sowie eine Lockerung der Schuldenregeln. Friedrich Merz möchte die Deckungslücke der Transformation durch eine Stärkung der Europäischen Kapitalmarktunion schließen und spricht dazu bei einer Veranstaltung des Vermögensverwalters BlackRock. Robert Habeck möchte soziale Sicherungssysteme durch Abgaben auf Kapitaleinkünfte “finanzieren”.
Doch was bedeutet es eigentlich, eine Transformation zu “finanzieren”? Wenn im allgemeinen Sprachgebrauch von “Finanzierung” die Rede ist, denken die meisten Menschen an die Beschaffung eines Geldbetrages, mit dem man eine größere Anschaffung oder ein größeres Projekt stemmen kann. Die Geldmittel stammen dabei entweder aus Ersparnissen oder aus einer Kreditvergabe durch Banken. “Finanzierung” steht somit meist für eine im weitesten Sinne privatwirtschaftliche Aktivität.
Im Rahmen der Finanzierung der Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft herrschten lange Zeit ganz ähnliche Vorstellungen vor. Der Begriff “Sustainable Finance”, zu Deutsch “Nachhaltige Finanzierung”, stand für eine Sichtweise, die großes Vertrauen in Marktmechanismen und privatwirtschaftliche Initiative setzte. Die Vorstellung war: Gelingt es dem Staat, einen ausreichend hohen Preis für klimaschädliche Emissionen zu etablieren, würden die flinken aber unsichtbaren Hände privater Finanzmärkte dafür sorgen, dass ökologisch schädlichen Geschäften die Mittel entzogen, zukunftsträchtigen grünen Anwendungen Geldmittel zugeführt würden.
Die Versprechen der privaten Finanzmarktakteure, die für die Transformation notwendigen Gelder aufzutreiben, haben sich bedauerlicherweise als leere Worte erwiesen. Dies zeigt bspw. ein Blick auf die Lücke zwischen klimapolitisch notwendigen und tatsächlich verfügbaren Finanzmitteln: Aktuell wird lediglich ein Fünftel der geschätzten Bedarfe aufgebracht, davon lediglich ungefähr die Hälfte aus privaten Quellen. Und dieses Fünftel der notwendigen Mittel stellt im Vergleich zu den Kleinstbeträgen, die bis vor Kurzem vorherrschten, bereits einen Erfolg dar, der nur mit Hilfe auf-wendiger staatlicher Maßnahmen erreicht werden: Der Staat übernimmt inzwischen einen erheblichen Teil der mit der Transformation einhergehenden Risiken und Kosten. Mit dieser Übernahme sind staatliche und überstaatliche Akteure selbst ein Versprechen eingegangen: Die Finanzierung der Nachhaltigkeitstransformation so zu fördern, dass sie am Ende gelingt.
Die Versprechen von Regierungen und Europäischer Kommission haben sich bedauerlicherweise ebenfalls als leere Worte erwiesen. Grundgesetzlich verankerte Schuldenbremsen lassen sich dauerhaft ebenso wenig ignorieren wie die institutionellen und demokratischen Defizite der Europäischen Union oder die Anfälligkeit bestimmter Wählergruppen für die rechtspopulistischen Versprechen von Klimaleugnern, die nicht selten die Interessen der alten, fossilen Wirtschaft vertreten. Zudem scheitert auch jedwede „hybride“, also im Zwischenraum zwischen privaten und öffentlichen Sphären angesiedelte Finanzierungslösung, wenn nicht ausreichend öffentliche Mittel zur Verfügung stehen.
Warum erweisen es bisher alle Versprechen, einen bestimmten Geldbetrag zur Finanzierung der Transformation aufzubringen, als leere Worte? Dieser Frage soll eine Tagung an der Evangelischen Akademie Tutzing nachgehen, die vom 10. bis zum 12. März unter dem Titel “Finanzpolitik für die Transformation” stattfinden soll.
Ausgangspunkt der Tagung ist die These, dass nicht nur die Finanzierungsmodelle privater und öffentlicher Akteure aus leeren Worten bestehen. Vielmehr handelt es sich bei dem Begriff “Finanzierung” selbst um ein “leeres Wort”, einen “Slogan” ohne festgelegte Bedeutung. Als bedeutungsoffenes “Label” kann der Begriff auf viele Arten und ganz unterschiedlich interpretiert werden und dabei unterschiedliche Überzeugungen und Agenden repräsentieren. Philosophen wie Jaques Derrida und Ernesto Laclau sprechen in diesem Zusammenhang von einem “empty signifier”. Ausgehend von diesem Begriff lassen sich einige Gründe finden, warum sich die meisten Versprechungen zur Finanzierung der Transformation als “leere Worte” erwiesen haben.
Der erste Grund, der zur Erklärung der bisher unzureichenden Transformationsfinanzierung beitragen kann, ist die Gleichsetzung von Finanzierungsfragen mit Fragen der Geldbeschaffung. Auf dieses Problem hat schon der wichtigste Ökonom des zwanzigsten Jahrhunderts, John Maynard Keynes, hingewiesen, der einen “Albtraum der Finanzierung” konstatiert. Dieser Albtraum entsteht als Folge der Gleichsetzung des Begriffs “Finanzierung” mit dem Aufbringen eines Geldbetrages. In Wirklichkeit geht es bei Finanzierungen, und gerade und im Besonderen bei der Finanzierung der Nachhaltigkeitstransformation, zunächst um materielle Fragen: Kann mit den Metallen aus Yachten eine S-Bahn “finanziert” werden? Können die seltenen Erden für E-Roller in Sao Paulo bei der Produktion von großen E-Automobilen in München “eingespart” werden?
Ein zweiter Grund für die bisher leeren Versprechungen besteht in der Ausblendung von Macht-fragen. Wer allerdings wie Macht ausübt bleibt im aktuellen politischen Diskurs oft ausgeblendet. Der strategische Einsatz “leerer Signifikanten” spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Herrschaft wird durch die Schöpfung und stetige Umwandlung solcher leerer Signifikanten ausgeübt. Es ergibt sich eine dynamische Wechselbeziehung, bei der Macht durch die Fähigkeit ausgeübt wird, unbestimmte und flexible Konzepte zu kontrollieren und in einem bestimmten politischen Kontext zu besetzen.
Der dritte Grund für leere Worte ist mit dem zweiten eng verwandt: Finanzierungsfragen sind immer auch Verteilungsfragen, gerade in der sozial-ökologischen Transformation. Denn die Folgen des Klimawandels treffen weniger gut finanzierte Menschen hart, vermögende Menschen weniger hart. Umgekehrt tragen Menschen mit guter Finanzausstattung überproportional, Menschen mit schlechter nicht oder nur wenig zu den Problemen bei. In ähnlicher Form sind auch die Möglichkeiten, zur „Finanzierung“ der Klimatransformation beizutragen stark ungleich verteilt. Und diese Verteilungsaspekte stellen nur den Anfang einer langen Reihe ähnlicher Probleme dar.
Das Finanzsystem ist mithin Kristallisationskern eines hegemonialen Diskurses, der Macht- und Ver-teilungsfragen verschleiert. Stattdessen werden “Gott und die Welt” in die Sphäre marktförmiger, auf den ersten Blick “neutraler” und “fairer” Bewertungen gebracht. Es kommt zu einer Fetischisierung des Finanzsystems, wie sie etwa der Begeisterung über handelbare Emissionsrechte zugrunde liegt. Den Klimaschutz endlich auch in den Orbit finanzmarktförmiger Bewertungen zu bringen wird zur Agenda einer um Hegemonie bemühten Gruppe einflussreicher Akteure.
Genau entgegen diesem über weite Strecken hegemonialen Diskurs ist es wichtig, “das Finanzielle” als Kombination dreier Aspekte zu begreifen: Als Ausdruck realer Machtverhältnisse, konfliktreicher Verteilungsprobleme und als Medium realwirtschaftlicher Ressourcenumschichtungen – im besten Fall in Richtung transformatorischer Prozesse des Wandels. Alle drei Aspekte sind miteinander verwoben. Dass Ressourcenumschichtungen (sei es zugunsten des Baus eines Radwegenetzes, sei es für nachhaltig Energieerzeugung oder wofür auch immer) finanzielle Voraussetzungen haben, zeigt letztlich an, dass sie nicht im luftleeren Raum stattfinden. Sie haben Voraussetzungen und Konsequenzen im Hinblick auf Materie, Macht und Verteilungskonflikte.
Über die Autoren:
Prof. Dr. Ulrich Klüh ist Professor für Volkswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Makroökonomie und Wirtschaftspolitik an der Hochschule Darmstadt. Er ist außerdem Gründungsmitglied und Sprecher des Vorstands des Zentrum für nachhaltige Wirtschafts- und Unternehmenspolitik (ZNWU) sowie Prodekan der Hochschule Darmstadt. Seine Forschungsschwerpunkte sind die politische Ökonomie und politische Ökologie der laufenden sozial-ökologischen Transformation, die Geschichte und Sozialtheorie des ökonomischen Denkens sowie die angewandte Geld-, Steuer- und Finanzwirtschaftspolitik. Prof. Dr. Richard Sturn ist Leiter des Graz Schumpeter Centres der Universität Graz und Präsident der European Society of the History of Economic Thought. Zu seinen Forschungsinteressen gehören Probleme der normativen Ökonomik, Ökonomie und Philosophie, Geschichte des ökonomischen Denkens, Institutionenökonomie sowie öffentliche Wirtschaft.
Hinweis:
“Finanzpolitik für die Transformation” heißt die Tagung, die vom 10. bis 12. März 2025 in der Evangelischen Akademie Tutzing stattfindet und die in Kooperation mit Ulrich Klüh und Richard Sturn entstanden ist. Die Tagung widmet sich privaten, öffentlichen und hybriden Finanzierungsformen sowie Finanzpolitik und -systemen in der Transformation. Ausführliche Informationen zur Veranstaltung sowie zu den Anmeldemodalitäten finden Sie hier.
Bild: Leere Worte – Symbolbild (Adobe Stock)