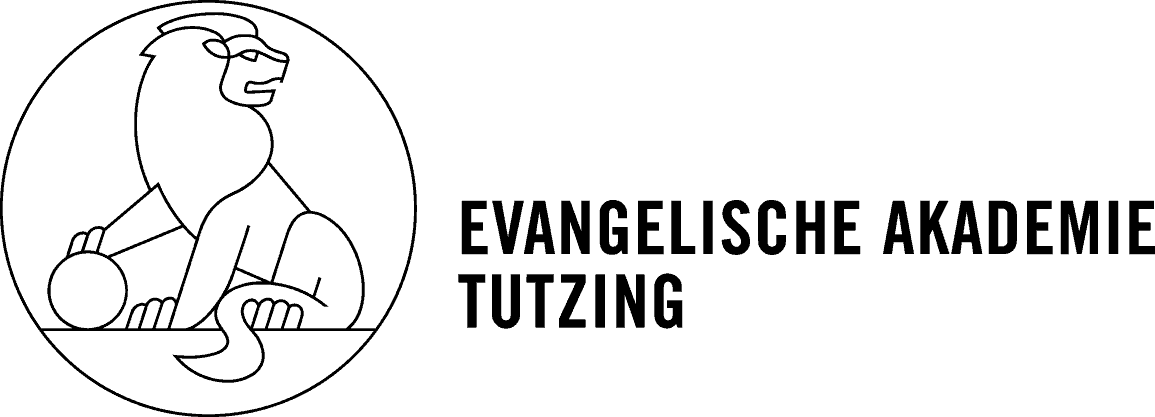Technik gegen Depressionen?
Apps als verschreibungspflichtige Medizinprodukte, Chatbots als Therapeut:innen, Empathie via Künstlicher Intelligenz? Der digitale Wandel wirkt sich auch auf das Gesundheitswesen aus. Auf der Tagung “Depression 4.0 – Psychisch gesund mit dem Smartphone?” vom 19. bis 20. Februar haben wir den Bereich der psychischen Gesundheit unter die Lupe genommen. Im Publikum saß auch der Gesundheitswissenschaftler Joseph Kuhn, der in diesem Beitrag seine Eindrücke zusammenfasst.
Von Joseph Kuhn
Die Digitalisierung hält gerade mit Macht Einzug im Gesundheitswesen. Das gilt auch im Bereich der psychischen Gesundheit. Einen regelrechten Boom gibt es derzeit rund um Apps. Manche können bereits auf Rezept verschrieben werden. Wenn Apps erfolgreich vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft wurden, gelten sie als DiGAs, Digitale Gesundheitsanwendungen, die von Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen auf Kosten der Krankenkassen verschrieben werden können. Es handelt sich dann rechtlich um Medizinprodukte. Etwa zwei Dutzend gibt es derzeit zur Unterstützung der psychischen Gesundheit, auch zur Hilfe bei Depressionen.
Als Vorteile werden häufig genannt: Sie können die Wartezeit auf einen Therapieplatz überbrücken, sie ermöglichen eine zeitlich flexible Unterstützung, es gibt weniger soziale Hemmschwellen und sie sind kostengünstig. Die Verschreibungskosten gab eine Referentin der Tagung mit 192 – 620 Euro an, wobei die Hersteller im ersten Jahr die Preise selbst festlegen. Die Entwicklungskosten lägen im Bereich zwischen 3 und 4 Millionen Euro. Der Nutzen der DiGAs muss dann nachgewiesen werden, aber das geht einfacher als bei Medikamenten.
Manche der DiGAs greifen auf Verhaltensdaten zurück, z.B. kombiniert mit einer SmartWatch, die Schritte zählt, den Schlaf überwacht oder andere Daten erfasst. Für die Industrie ist das ein Wachstumsmarkt und zusammen mit der Erschließung der Versorgungsdaten und der Entwicklung von KI-Anwendungen herrscht durchaus so etwas wie Goldgräberstimmung. Nach dem Hirnforschungshype jetzt also der Digital- und KI-Hype?
Ob die DiGAs wirklich so uneingeschränkt positiv zu sehen sind, oder ob sie wie alle Mittel Nebenwirkungen haben, ob sie wie auch die herkömmlichen psychosozialen Hilfen in einem Spannungsfeld von Unterstützung und Kontrolle angesiedelt sind – und ob sie eine Mechanisierung, also eine Entmenschlichung der psychotherapeutischen Beziehung bewirken, nur eine Simulation einer menschlichen Beziehung darstellen, das waren die Kernthemen der Tagung in Tutzing.
Einige Studien zeigen, dass Chatbots manches besser können als menschliche Therapeuten, dass sie z.B. manchmal als empathischer wahrgenommen werden. Aber ist Empathie nicht eine ganz spezifische Qualität der zwischenmenschlichen Beziehung? Wie “echt” ist die künstliche Empathie? Täuscht sie nicht nur etwas vor? Und wenn man das bejaht, weil die KI ja nicht wirklich mitfühlt, ist dieser “digitale Animismus”, wie es einer der Referenten nannte, schlimm? Zählt letztlich bei der psychischen Gesundheit nicht, wie sich die Patient:innen fühlen? Was sonst ist der Erfolgsmaßstab bei einer Depression? Oder wäre das dann wie bei der Homöopathie: wenn die Leute glauben, dass es hilft, dann sollen es die Krankenkassen eben bezahlen?
Auf jeden Fall hat es etwas zu bedeuten, wenn menschliche Therapeuten in Studien als weniger empathisch wahrgenommen werden als eine KI. Man sollte die “menschliche Beziehung” in Therapien auch nicht zu sehr idealisieren, gerade was die Psychiatrie angeht und nicht nur, was ihre mörderische Vergangenheit angeht.
Das gilt umso mehr, als bislang auch außerhalb von therapeutischen Beziehungen immer der Mensch das absolut Unmenschliche repräsentiert hat. Überhaupt: Ist “Technik” wirklich das ganz Andere des Menschlichen? Oder ist Technik vielleicht menschlicher als man zunächst glaubt, ein Teil des Menschseins, und die KI projiziert menschliche Fähigkeiten nur in eine neue Realisationsform?
Wie dem auch sei: Menschliche Beziehungen in ihrer Gesamtheit können DiGAs und ihre Verwandten nicht ersetzen. Wir sind keine Zylonen. Aber sie können wohl manche Aufgaben erledigen, die bisher als unhintergehbar in der menschlichen Beziehung zwischen Therapeut und Patient verortet wurden.
DiGAs bzw. andere digitale Produkte werden, das zeichnet sich ab, ihren Platz im Gefüge der psychosozialen Versorgung finden. Man wird im Laufe der Zeit klarer sehen, wofür sie geeignet sind, wofür nicht und welche regulatorischen Leitplanken nötig sind, damit der Nutzen für die Industrie nicht größer ist als der für die Patienten. Dazu sind Studien nötig, vor allem auch industrieunabhängige Studien, die Nutzen und Risiken in konkreten Anwendungsfeldern untersuchen, dabei auch partizipativ Patient:innen und Therapeut:innen einbinden, und dazu sind Gesprächsforen wie die in Tutzing nötig, um die umwälzenden technischen Entwicklungen zu verstehen und einzuordnen. Denn über ihre spezifischen Leistungen hinaus verändern insbesondere KI-gestützte Anwendungen natürlich auch das Selbstbild der Menschen. Dagegen braucht es keine KI, um vorherzusehen, dass das nicht die letzte Tagung zu diesem Thema in Tutzing war.
Hinweis:
Dieser Text ist ursprünglich bei scienceblogs.de erschienen (zum Artikel).
Wir danken dem Autor für die Erlaubnis, seinen Text auch auf dem Blog der Evangelischen Akademie Tutzing veröffentlichen zu dürfen.
Bild: Während der Tagung “Depression 4.0 – Psychisch gesund mit dem Smartphone?” vom 19. bis 20. Februar (Foto: Meyer-Magister / eat archiv).