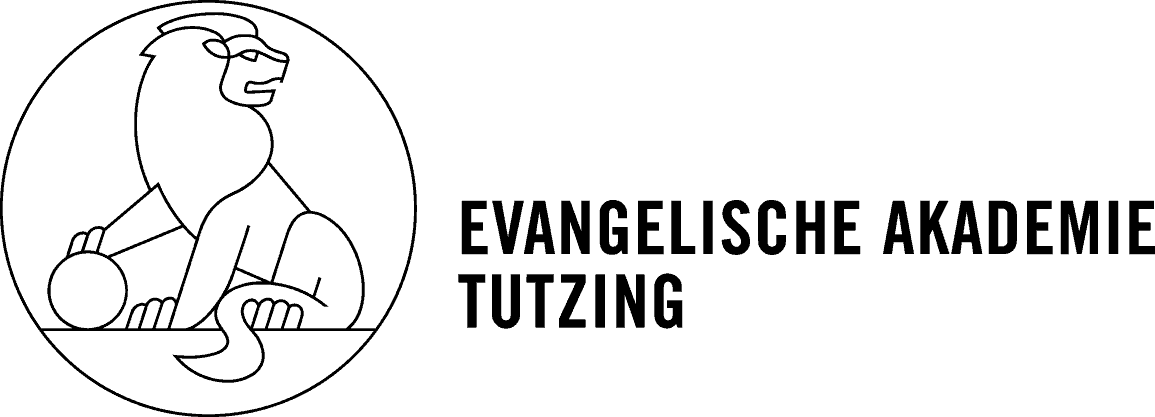Höhere Bildung als Aufstiegsgarant – für wen eigentlich?
“Nein, wir haben noch nicht genug von der Wirklichkeit der Arbeiter gesprochen, schon gar nicht der Arbeiterinnen.” Das findet die Autorin Marlen Hobrack. In ihrem Buch “Klassenbeste. Wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet.” hat sie ihre eigene Geschichte aufgeschrieben – den Weg vom Arbeiterinnenkind ohne finanzielle Privilegien und mit DDR-Biografie zur Akademikerin. In diesem Text schreibt sie über problematische Aufstiegskonzepte, Leistungsbegriff und Bildungsgerechtigkeit.
Von Marlen Hobrack
Ich bin ein ostdeutsches Arbeiterkind. Ich wurde 1986 geboren, in der Endphase der DDR, sozialisiert wurde ich also zum allergrößten Teil in der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik, so konnten wir es über Jahrzehnte hinweg bei Soziologen und Politologen lesen, sei eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft, alle Klassenunterschiede seien aufgehoben. Warum sollte man heute darüber sprechen, dass man Arbeiterkind ist? Und warum die identitätspolitische Verortung als Ostdeutsche, mehr als drei Jahrzehnte nach der Wende? Sind solche Verortungen nicht ein Schritt zurück, haben wir das Teilende nicht überwunden?
Sie ahnen es, ich hätte diesen Text nicht geschrieben, wenn ich es für ausgemacht hielte, dass es keine sozialen oder ökonomischen Differenzen zwischen den Klassen, zwischen Ost- und Westdeutschen gäbe.
Im letzten Jahr erschien mein Buch Klassenbeste. Wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet. Darin erzähle ich meinen eigenen Bildungsaufstieg vor dem Hintergrund der Arbeiterinnenbiografie meiner Mutter, die in der DDR geboren und sozialisiert wurde. Meine Mutter erlebte selbst einen Aufstieg, nicht durch höhere Bildung, für die ihrer Familie das Geld fehlte, sondern durch harte Arbeit. Meine Mutter verließ die Schule nach der neunten Klasse, erwarb im Zuge ihrer Facharbeiterausbildung ihren Oberschulabschluss und wurde schließlich zur Beamtin in einer Justizvollzugsanstalt. Die älteste Tochter von sieben Kindern, die aus ärmsten Verhältnissen stammte, war so in der Mitte der Gesellschaft angelangt, ihre drei Kinder machten Abitur und studierten. Wenn das nicht die Erfüllung des bundesrepublikanischen Aufstiegsversprechens ist, was dann?
Die Biografien hinter den Bildungsstatistiken
Wie immer ist alles ein wenig komplexer als es auf den ersten Blick scheint. Dass meine Mutter zur Wendegewinnerin wurde, statt wie viele andere ostdeutsche Frauen nach 1989 ihren Job in der Produktion zu verlieren, war eher einem Zufall geschuldet. Dass meine Geschwister und ich keine Lernschwierigkeiten hatten, war ein Glück. Für unseren Bildungserfolg mag entscheidend gewesen sein, dass in unserer Generation in Ostdeutschland Bildungserfolg und Status bzw. Einkommen der Eltern noch nicht so eng gekoppelt waren, wie es Bildungsstudien für die Bundesrepublik seit Jahren belegen. Jüngst vermerkte der Chancenmonitor des ifo-Instituts ein “frappierendes Ausmaß” an Chancenunterschieden zwischen Kindern aus “bildungsnahen” und “bildungsfernen” Haushalten. Sowohl das Einkommen der Eltern als auch deren Schulabschluss gehören zu den wesentlichen Kriterien, die über Bildungserfolg entscheiden.
Bildungsgerechtigkeit ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Wenn wir so häufig beschwören, Deutschland müsse ein Land der klugen Köpfe sein, weil es nun einmal über keine nennenswerten Rohstoffe verfüge, ist es auf ökonomischer Sicht schädlich, die Bildung von Kindern zu vernachlässigen. Setzt man die ökonomische Brille ab, erkennt man, dass sich hinter den Statistiken Biografien verbergen. Ob ein Mensch einer sinnstiftenden Arbeit nachgehen kann, mit der er ein vernünftiges Einkommen erwirtschaftet, ist keine Nebensächlichkeit. Wir sind längst an einem Punkt angelangt, an dem es nicht nur an Geld mangelt, um gute Bildung zu gewährleisten. Momentan mangelt es vor allem an den Köpfen – den gut ausgebildeten Lehrern. Der eklatante Lehrermangel, den wir derzeit beobachten, schreibt die soziale Spaltung im Bildungswesen auf Jahrzehnte fort.
Bildungsgerechtigkeit heißt nicht: Alle müssen studieren
Das gesellschaftliche Ziel kann und muss es nicht sein, dass möglichst viele, gar alle studieren. Unzählige Menschen sind glücklich in Berufen, in denen praktische oder soziale Arbeit am Menschen geleistet wird. Bei Bildungsgerechtigkeit geht es nicht darum, alle zum Studium zu führen; vielmehr sollen diejenigen, die dazu befähigt sind, studieren können, ohne Nachteile aufgrund des Status ihrer Eltern in Kauf nehmen zu müssen.
Ich schreibe das, weil wir seit Jahrzehnten ein problematisches Aufstiegskonzept vertreten. Der Königsweg zum Aufstieg (oder Klassenerhalt) sei höhere Bildung. Dann ist klar, dass viele Mittelschichtseltern alles dafür tun, dass ihre Kinder Abitur machen und studieren, selbst wenn das weder ihren Neigungen noch Fähigkeiten entsprechen mag. Neulich trat nach einer Lesung ein Lehrerehepaar auf mich zu. Ihre beiden Söhne hätten sich gegen ein Studium und für eine Ausbildung entschieden. Beide arbeiten bei einem Automobilhersteller am Fließband (ich nehme an, sie verdienen mehr Geld als so mancher Akademiker) und seien sehr glücklich damit. Die Freunde des Ehepaars hätten ihm allerdings Vorwürfe gemacht: Wie konnten sie es zulassen, dass sich ihre Söhne gegen ein Studium entschieden?
Leistung muss umgedeutet werden
Diese Bildungs- und Aufstiegskrux führt dazu, dass immer mehr junge Menschen Abitur machen und studieren, wodurch die höheren Abschlüsse entwertet werden. In Ostdeutschland gilt ein Abitur inzwischen als Voraussetzung für viele Ausbildungsberufe. Wir wissen, dass just jene Menschen besonders systemrelevant sind, die oftmals schlecht bezahlt werden und unter lausigen Bedingungen arbeiten. Meine Mutter kann ein Lied davon singen, seit sie als Reinigungskraft arbeitet (sie konnte sich auch nach ihrer Pensionierung ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellen). Es nützt aber nichts, diesen Menschen zu sagen, sie hätten genauso gut studieren können. Vielmehr ist es unsere gesellschaftliche Pflicht, Arbeiterberufe fair und leistungsgerecht zu entlohnen. Leistung ist nicht nur das, was Akademiker am Schreibtisch vollbringen. Die Umdeutung von Leistung wäre ein wirklicher Schritt zur Gerechtigkeit für Angehörige der Arbeiterklasse, deren Körper oft frühzeitig im Leben starke Verschleißerscheinungen zu spüren bekommen und die nicht bis zum 65., 67. oder gar 70. Lebensjahr durcharbeiten können. Es ist nur ein Teil der Wahrheit, wenn wir sagen, wir alle werden immer älter. Tatsächlich gibt es einen erheblichen Unterschied in der Lebenserwartung etwa zwischen Arbeitern und Beamten – er beträgt zurzeit ganze zehn Jahre!
Meine Mutter ist inzwischen 69 Jahre alt. Mit zwölf Jahren arbeitete sie zum ersten Mal an einem Fließband; es handelte sich um einen Ferienjob, der das Einkommen der Familie aufbessern half. 57 Jahre in der Arbeitswelt – wenn das keine Lebensleistung ist! Ganz nebenbei hat sie drei Kinder großgezogen und – typisch für ostdeutsche Frauen ihrer Generation – dafür ihre Berufstätigkeit nur kurz unterbrochen. Wenn wir über die Erhöhung des Renteneintrittsalters nachdenken, sollten wir an Biografien wie die meiner Mutter denken.
“Das Thema geht nicht weg”
Neulich trat eine Frau vor einer Lesung auf mich zu. Sie war sehr teuer gekleidet, bereits im Rentenalter und wirkte ein wenig empört. Sie habe gesehen, dass ich ein Buch über Arbeiterinnen geschrieben habe. Ich sei da wohl “vorbelastet” (ich verstand nicht ganz, was sie meinte). Aber man habe ja nun genug über Arbeiter gesprochen. Überall lese man nur noch von Arbeitern!
Ich bat sie höflich, sich erst die Lesung anzuhören. So oder so würde ich rigoros widersprechen: Nein, wir haben noch nicht genug von der Wirklichkeit der Arbeiter gesprochen, schon gar nicht der Arbeiterinnen. Tatsächlich aber benannte die Frau meine große Sorge: Dass auf den jetzigen Boom des Sprechens über die Arbeiterinnenklasse oder über “Klassismus”, also die Diskriminierung auf Basis von Klassenzugehörigkeit, eine Art Sättigung folgen könnte. Doch so lange sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse (übrigens nicht nur hierzulande, sondern auch global betrachtet) nicht verbessert haben, solange wie Bildungs- und Lebenserfolg unmittelbar an Status und Einkommen der Eltern gekoppelt sind, werden wir über dieses “leidige” Thema noch lange sprechen müssen. Das Thema geht nicht weg. Es ist kein Trend. Es ist entscheidend für Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt in diesem Land.
Zur Autorin:
Marlen Hobrack wurde 1986 in Bautzen geboren und studierte in Dresden Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaften sowie Kunstgeschichte. Einige Jahre lang arbeitete sie bei einer Unternehmensberatung. Seit 2016 ist sie hauptberuflich als Autorin, Kolumnistin, Literaturkritikerin und Moderatorin für die ZEIT, TAZ, den FREITAG, die Welt, EMMA, STADTLUFT Dresden, MONOPOL u.v.m. tätig. Sie hat zwei Bücher veröffentlicht: “Schrödingers Grrrl” und “Klassenbeste. Wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet.” Sie lebt mit ihrer Familie in Leipzig.
Weitere Infos auf ihrer Homepage: https://www.marlen-hobrack.de/
Hinweis:
Marlen Hobrack ist zu Gast in unserer Politikwerkstatt vom 5.-7. Mai 2023. Am Sonntag, 7. Mai wird sie via Online-Schalte ausgehend von ihrem Buch “Klassenbeste. Wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet.” über Fallschirmmütter, Aufstiegsmythen und den Selbstbetrug der Mittelschicht sprechen.
Alle Informationen zu Ablauf, Referierenden und Anmeldemodalitäten zur Tagung des Jungen Forums unter diesem Link.
Bild: Marlen Hobrack (Foto: Marcus Engler)