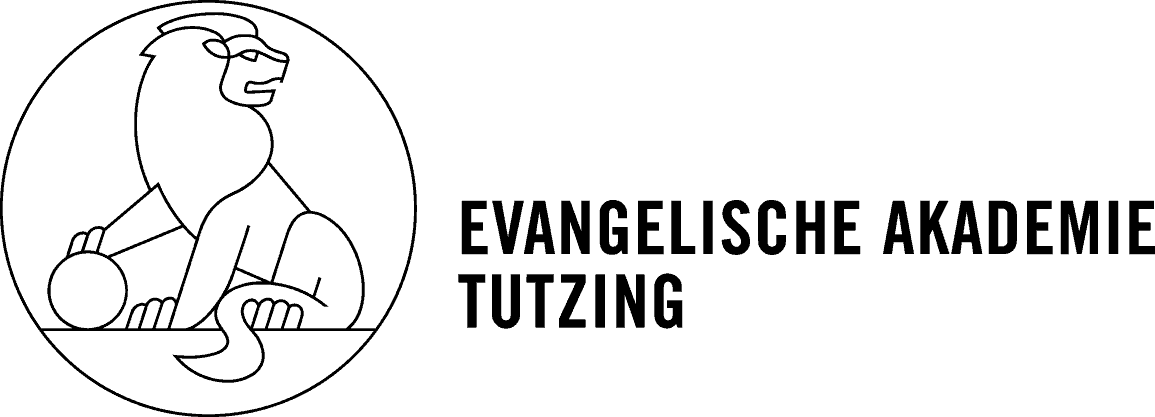Zwischen "Zeitenwende" und "Wandel durch Annäherung"
Unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine beschäftigte sich die Herbsttagung des Politischen Clubs im November mit dem Themenkomplex “Deutschland und Osteuropa”. Dabei ging es um unter anderem um geschichtliche Aufarbeitungen, Perspektivwechsel, Sicherheitspolitik, mittel- und osteuropäische Realitäten, geopolitische Überlegungen, Energiesicherheit und (überholte) Denkmuster. Zum ausführlichen Bericht
In seiner ersten Veranstaltung als Leiter des Politischen Clubs packte der Autor und Publizist Roger de Weck gemeinsam mit Akademiedirektor Udo Hahn das Thema des Jahres 2022 an: den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der am 24. Februar 2022 begann. Die Herbsttagung des Politischen Clubs beleuchtete den Krieg, seine Ursachen, Folgen und Zukunftsszenarien unter dem Aspekt der Beziehungen, Abhängigkeiten und unterschiedlichen Perspektiven von “Deutschland und Osteuropa” (zum Programm).
Als Ausgangspunkt setzen Roger de Weck und Udo Hahn die Feststellung, dass die lang erfolgreiche Ostpolitik Willy Brandts, die Egon Bahr am 18. Juli 1963 in der Evangelischen Akademie Tutzing erstmals dargelegt hatte, inzwischen nicht mehr aufgeht. In ihrer Einladung hieß es: “‘Wandel durch Annäherung’? Der Freihandel hat nicht den erwünschten Wandel gebracht. Russland ist diktatorisch geworden (und China noch totalitärer). Deutschland, aber auch andere EU-Länder haben sich in einer Abhängigkeit von Russland verstrickt.” Der Angriffskrieg auf die Ukraine habe langjährige deutsche Gewissheiten erschüttert: “Der ‘Exportweltmeister’ leidet an der einsetzenden Deglobalisierung, an der Fragilität der Lieferketten, an der Ungewissheit auf Schlüsselmärkten. Der ‘Importweltmeister’ in Sachen Erdgas muss seine Energieversorgung so rasch wie möglich umbauen. Wo früher EU-Partner an die Solidarität der Bundesrepublik appellierten, ist sie nun auf deren Solidarität angewiesen. Das Verhältnis zu Mittel- und Osteuropa, deren Exponentinnen und Exponenten vergeblich vor dem Putinschen Imperialismus gewarnt hatten, ist belastet. Die schwere ‘Lesbarkeit’ deutscher Politik, jedenfalls zu Beginn des Kriegs, kostete Glaubwürdigkeit bei den Partnern: darunter besonders schwierige Länder wie Polen, das sich von Demokratie und Rechtsstaat entfernt hat.”
Wie sieht 2022 eine zukunftsfähige Ostpolitik aus?
Die Tagung begab sich auf die Suche nach einer neuen Ostpolitik und ging dabei vor allem diesen Fragen nach: Wie lässt sich das Verhältnis zu den mittel- und osteuropäischen EU-Partnern neugestalten? Was ist im Rahmen der EU zu tun? Wie könnte eine zukunftsfähige Ostpolitik aussehen und worin liegt morgen die sicherheitspolitische Rolle Deutschlands in Europa? Was bedeutet der Abschied von der Versorgungssicherheit?
Den Auftaktvortrag zur Tagung hielt Janusz Reiter. Er war von 1990 bis 1995 Botschafter von Polen in Deutschland, von 2005 bis 2007 Botschafter in den USA. Reiter berichtete von seiner ambivalenten Einstellung zum Motto von Egon Bahr “Wandel durch Annäherung”. Selbst die beste Idee überdauere sich irgendwann einmal – so sei es auch mit dieser. Das Motto habe seiner Meinung nach zu lange gegolten, sei schon in den 1980er Jahren an seine Grenzen gestoßen, als die ersten Bürgerrechtsbewegungen in Polen aufkamen, die in den meisten Fällen (bis auf Solidarnösc) keine Systemfrage stellten. So trug nach der Auffassung Reiters die Ostpolitik Brandts dazu bei, den Status Quo von etwas zu wahren, das eigentlich überwunden werden sollte. In diesem Zusammenhang äußerte Reiter auch Kritik an Politiker: innen, die Russland lange als “Nachbar” Deutschlands bezeichnet und dabei Polen übergangen hätten. Erst jetzt würde hier ein Wandel im Denken einsetzen.
Deutschland, Polen und Russland: eine “schwierige Dreiecksbeziehung”
Das Verhältnis zwischen Deutschland, Polen und Russland bezeichnete er als “schwierige Dreiecksbeziehung”. Während sich Polen und Russland seit dem 16. Jahrhundert in harten geopolitischen Auseinandersetzungen befunden hätten, habe Deutschland heutzutage asymmetrische Beziehungen zu beiden Ländern und sei sich nicht seiner eigenen Macht bewusst. Verschiedene Formate prägen die Geschichte der Dreiecksbeziehung: Das “Weimarer Dreieck”, ein diplomatisches Dialogformat zwischen Deutschland, Frankreich und Polen, das sich im Jahr 1991 auf die Initiative von Hans-Dietrich Genscher gründete und für das, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, laut Reiter “die Zukunft im Westen lag”. Parallel dazu gründete sich 1991 die “Visegrád-Gruppe”, ein Bündnis zwischen Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei. Beide Gruppen seien aktuell jedoch nicht mehr sehr vital, meinte Reiter. Das Weimarer Dreieck erklärte er gar für “hirntot”. Für Polen sei in Bündnissen wichtig, nicht als “Junior-Partner” gesehen zu werden. Es sei ein Schock für Polen gewesen, als das “Normandie-Format” (Russland, Deutschland, Frankreich, Ukraine) etabliert wurde, um zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln – etwas, das bis dahin durch das “Weimarer Dreieck” geschehen war. Polen sei dadurch das Gefühl vermittelt worden, “klein gehalten” zu werden.
Hinsichtlich des Verhältnisses Deutschland-Polen-Russland sei ein gemeinsames Format nur schwer denkbar. “Das ist kein Dreieck”, sagte Reiter. Es gebe zum einen zu viele historisch bedingte Zerwürfnisse, zum anderen gebe es auch keine Stadt, die für ein Treffen geeignet wäre, und die alle drei Länder akzeptieren würden.
Hätte der Kalte Krieg eine Erklärung “für alles” geboten, suche man seit dem Zusammenbruch des Ostblocks Erklärungsmuster. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands hätte es eine Art “Ende der Geschichte” gegeben. In Polen hätte eine Begeisterung geherrscht, endlich aus der “Zwischenlage” zwischen Deutschland und Russland herauszukommen. Die jetzige polnische Regierung sei von einem Misstrauen gegenüber Deutschland geprägt, so Reiter. “Nach der Öffnung der Grenzen kommt die Angst vor den Grenzen der Öffnung”, fügte er hinzu.
Zukünftig könnte den baltischen Staaten eine größere Rolle zukommen, auch hinsichtlich der Sicherheitspolitik in Europa. An Deutschland und Polen gewandt sagte Reiter: “Die Zeit, in der wir den Luxus hatten, uns aus der Weltpolitik rauszuhalten, ist vorbei.” Der russische Revisionismus sei ein politischer Faktor, mit dem beide Länder nun umgehen müssen – ohne fatalistisch zu sein, aber indem man die Schlussfolgerungen der Geschichte neu formuliere. In der anschließenden Debatte mit dem Publikum äußerte Janusz Reiter den Satz: “Deutschland ist ein Teil des Problems, aber noch viel mehr ein Teil der Lösung!”
Prof. Dr. Manuel Fröhlich, Politikwissenschaftler und Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Beziehungen und Außenpolitik an der Universität Trier, ging als nächstes im Gespräch mit Roger de Weck auf die Ostpolitik Deutschlands ein. In Bezug auf das Konzept von Willy Brandt äußerte auch Fröhlich Kritik. Der Begriff habe sich irgendwann einmal “selbständig gemacht” und dabei auf einem westpolitischen Fundament gestanden. Der Politologe Fröhlich schlug als wegweisend für eine neue Ostpolitik die Prinzipien von des früheren US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt vor, die dieser unter den “Vier Freiheiten” eines Menschen 1941 in seiner Rede zur Lage der Nation beschrieben hatte. Die Sicherheit eines jeden Menschen gründe auf vier Freiheiten: Die der Rede und des Ausdrucks, die Freiheit jeder Person, Gott auf ihre eigene Weise zu verehren, die Freiheit von Furcht und die Freiheit von Not. Diese vier Freiheiten seien nicht nur “genial formuliert”, sie beschrieben auch eine Art Gegenprogramm zur Politik der Achsenmächte, sagte Manuel Fröhlich. 1942 nahmen die Vereinten Nationen sie mit in ihre Erklärung auf. Willy Brandt habe 1943 im Exil in Stockholm die “Friedensziele der demokratischen Sozialisten” als politisches Programm für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg skizziert. Diese seien in seiner Abschiedsrede von 1987 wieder aufgetaucht – daneben die “Freiheit von Furcht und Not” von Roosevelt. Fröhlich erwähnte auch den Begriff der “Weltinnenpolitik”, der bei Brandt auftauchte und der später von Richard von Weizsäcker wieder aufgegriffen wurde.
“Unreife Debatte”
In der weiteren Debatte kritisierte Fröhlich die Debatte über Russland als “unreif”. Das Russland heute sei nicht mehr dasselbe wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der aktuelle Konflikt Russlands mit der Ukraine (und dem Westen), sei eben kein Ost-West-Konflikt, sondern ein Infragestellen der Weltordnung seitens Russlands. Es gebe in der politischen Theorie sowohl die Logik der Konsequenz als auch die Logik der Angemessenheit. Mit dem Unterschreiben der Uno-Rechtspflicht habe auch Russland sich zu den gemeinsamen Regeln bekannt. Wenn das Land nun diese Regeln verletze und ein weiteres Land in dem Bündnis der insgesamt 193 Staaten angreife, dann müsse es dafür auch belangt werden.
Manuel Fröhlich forderte außerdem neue Begrifflichkeiten, die mehr erklären, für welche Prinzipien Deutschland stehe. Der Begriff “Zeitenwende” sei ihm zu “passiv”. Er würde gerne die Frage beantwortet wissen: Wie lautet nun der Handlungsauftrag?
Als weiterer Referierender sprach der Pfarrer und letzte Außenminister der DDR, Markus Meckel. (Seine Erinnerungen an die Wendezeit hat er 2020 im Buch “Zu wandeln die Zeiten: Erinnerungen” festgehalten.) Meckel ist zugleich Ko-Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit als auch Vorsitzender der deutsch-belarussischen Gesellschaft. Auf der Herbsttagung des Politischen Clubs sprach er zum Thema “Zeitenwende – vom alten Denken zur neuen Politik”. Hinsichtlich Krieges in der Ukraine konstatierte er: “Was wir erleben, hat Züge eines Vernichtungskrieges, auch wenn wir mit dem Begriff vorsichtig sein müssen.” In Russland regiere ein autokratischer Präsident, der Angst vor Freiheit und Demokratie habe, “denn das könnte in Russland ja Schule machen.” Damit unterscheide sich Putin ganz grundsätzlich von Michail Gorbatschow, der bereits Mitte der 1980er Jahre intervenierte, wenn Freiheit und Demokratie als rein “westliche Werte” reklamiert wurden. Meckel selbst sagte, er habe den “brutalen Eroberungskrieg” Putins nicht für möglich gehalten (mehr auch im Interview mir SWR 2 vom 11.11.2022: Markus Meckel: Krieg in der Ukraine ist Ergebnis unserer Politik – SWR2)
Der von Bundeskanzler Scholz geprägte Begriff der “Zeitenwende” beinhalte mehrere Aspekte, so Meckel. Zum einen seien durch Deutschlands Unterstützung der Ukraine Dinge möglich geworden, die kurz zuvor nicht diskutabel waren: etwa der Konsens für einen Zwei-Prozent-Etat für Verteidigung. Meckel sprach sich für uneingeschränkte Unterstützung der Ukraine aus, notfalls sollte Deutschland auch Flugzeuge zur Verteidigung an die Ukraine liefern. Auch das Denken hinsichtlich Geflüchteten habe sich in Deutschland “grundlegend” geändert. Er äußerte die Befürchtung, dass Putin in diesem Krieg nicht nur Energie als Waffe benutzt, sondern auch die Zivilgesellschaft. Geflüchtete könnten als “Waffe gegen den Westen” eingesetzt werden.
Der Begriff der “Zeitenwende” sollte, so Meckel, mehrere Prozesse anstoßen. Zum einen sollten Konzepte und Denkmuster neu hinterfragt werden. Die Phase der Ostpolitik Brandts (und des Motto Egon Bahrs) habe zu einem Denken in Einflusszonen geführt, zu Kategorien von Staaten und Vermächtnissen. Putin greife nicht nur die Ukraine an, sondern auch die Ordnung des internationalen Rechts, die UN-Charta, die auf der Erfahrung der beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert fuße. Putins Krieg gehe aus diesem Grund auch uns in Deutschland unmittelbar an. Wo Regeln verletzt werden, gelte es nun, Bündnisse zu stärken.
Meckel forderte darüber hinaus einen neuen Prozess in der Denkschrift zur Evangelischen Friedensethik. Schon allein die Forderung nach Frieden werfe Fragen auf: Welcher Friede ist gemeint? Eine Waffenruhe, zunächst mit Belassen der aktuell besetzten Gebiete – oder ein vollständiger Rückzug der russischen Armee?
Ein europäisches Institut zur Aufarbeitung der Geschichte?
In einem weiteren Punkt kam Meckel auch auf das Nachdenken über die Geschichte zu sprechen – ohne die kein Nachdenken über Außenpolitik möglich sei. Zu lange seien die Länder im Osten Europas nur auf Moskau bezogen worden. In der russischen Erinnerungskultur werde der Hitler-Stalin-Pakt ausgeklammert, genauso wie der Molotow-Ribbentrop-Pakt. Auch eine deutsche Verantwortung gelte es zu thematisieren: Katyn (Polen). Er forderte aus diesem Grund ein europäisches Institut zur Aufarbeitung der Geschichte. Auch die historischen Narrative, die gegenwärtig in Russland verbreitet werden, müssten hier untersucht werden.
Hinsichtlich der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik kritisierte Meckel das “Kaputtsparen der Bundeswehr und des Auswärtigen Amtes”, auch die Kommunikation müsse hier dringend verbessert werden. Darüber hinaus sei eine “Neukonstituierung des Westens” nötig. Deutschland müsse sich fragen: Wie verlässlich sind wir als Deutsche, wenn wir europäisch agieren wollen? Die Nato müsse sich hier neu aufstellen und auch innerhalb der Europäischen Union brauche es einen “eklatanten Politikwechsel”, die auch die EU-Frage der Ukraine in Angriff nehmen müsse. Meckel schlug für die Ukraine statt Beitrittsverhandlungen zunächst einen zügig umgesetzten Beobachterstatus im Europäischen Parlament vor. Meckel kritisierte die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel: “Unter Merkel ist die EU zu einer EU des Rates geworden, nicht der Parlamente und der Institutionen. Das muss sich ändern!”. Meckel außerdem: “Wir können keine Demokratie exportieren, aber wie können Demokratien unterstützen.”
“Erlernte Hilflosigkeit”
Via Online-Meeting war im Anschluss die deutsch-ukrainische Politikerin, Publizistin und Psychologin Marina Weisband zugeschaltet und sprach zur Frage: “Vor einer neuen Weltordnung?”. Sie stieg in ihren Vortrag mit einem psychologischen Ansatz ein: dem des Selbstwertgefühls. In den früheren Ländern der Sowjetunion, die unterschiedliche kulturelle Hintergründe hätten, habe sich ab den 1930ern eine Tradition der Autorität etabliert, die dem Individuum bis heute jegliches Selbstwertgefühl und jegliche Selbstwirksamkeit abspreche: “Der Mensch ist Staub, was zählt ist das Große.” In einem Akt “erlernter Hilflosigkeit” würden sich Menschen gedanklich selbst unterdrücken.
Jedoch lebe Demokratie von Unabhängigkeit, es sei dringend nötig, dass die Menschen in den früheren Sowjetstaaten Selbstwirksamkeit erfahren und “sich nicht von jemandem abhängig machen, der an einem Gestern festhält, um das Morgen zu zerstören.”
Putin kämpfe auch, um die Welt der Industrialisierung zu erhalten – die unmittelbar mit politischen und ökonomischen Abhängigkeiten verbunden sei. Jedoch: “Selbstwert zieht sich nicht aus materiellem Wohlstand”. Marina Weisband erzählte von ihren Erfahrungen mit Selbstwirksamkeit, die während der Proteste auf dem Maidan in der Ukraine begonnen hätten. Dort habe sie erlebt, wie sich Menschen in Hundertschaften selbst organisiert hatten und ein neues Selbstbewusstsein erwachen konnte.
Verflechtung von Politik und Religion
Sie plädierte für neue Formen der politischen Beteiligung und für eine Stärkung der demokratischen Infrastruktur. Dass das Wahlalter auf europäischer Ebene auf 16 Jahre abgesenkt worden sei, sei eine der besten Nachrichten in den Tagen zuvor für sie gewesen. Sie sagte: “Wenn Demokratie stärker werden soll, dann muss die Demokratie mehr werden.” Ein Nachgeben gegenüber Putin oder ein einfacher Waffenstillstand sei keine Zukunftsoption für die Ukraine. Putin begreife Entgegenkommen nicht als Freundlichkeit, sondern als Schwäche. Das sei schon in der Tradition des Zarentums gängiges Wahrnehmungsmuster gewesen. Außerdem meinte sie: “Wann immer wir einen Aggressor belohnen, ermuntert das nicht nur ihn, sondern auch Aggressoren auf der ganzen Welt.” Sie ermunterte zum Ende ihres Vortrags dazu, mit dem Gedanken Frieden zu schließen, dass die Welt sich ändert, Veränderung aber nicht das Ende bedeuteten.
Auf die Verflechtung von Politik und Religion ging der Stefan Kube, Leiter des Ökumenischen Forums für Glauben, Religion und Gesellschaft in Ost und West in Zürich ein. Er beleuchtete zunächst die Verflechtungen von Politik und Religion in Russland, danach die in der Ukraine, die Folgen des russischen Angriffskriegs und Szenarien für eine zukunftsfähige Ostpolitik.
Dabei erwähnte er auch die komplexe ukrainische Kirchenlandschaft, die gespaltene Orthodoxie und das Verhältnis der Kirchen zum Kreml. In der Verflechtung von Religion und Politik in Russland beschrieb Kube eine fortschreitende Radikalisierung, die sich in der Haltung von Patriarch Kirill zum russischen Staat zeige. Habe dieser sich zunächst für Frieden ausgesprochen, habe er schließlich im März 2022 einen “metaphysischen Kampf” beschrieben, der sich in einer “Gay Pride Parade” offenbare (Predigt vom 6.3.2022 zum “Sonntag der Orthodoxie”). Im September bat Kirill die Gläubigen seiner Kirche, für “unsere Armee zu beten”, die nur dann das Schwert zücke, wenn “es moralisch, sittlich und sogar geistlich gerechtfertigt ist.”
Demgegenüber stünde in der Ukraine eine pluralistische Kirchenlandschaft der Politik gegenüber: zwei große orthodoxe Kirchen, drei katholische Kirchen (ukrainisch-griechisch-katholisch, ruthenisch-griechisch-katholisch, römisch-katholisch), mehrere protestantische Kirchen (Baptisten, Pfingstbewegung, Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche der Ukraine, reformierte Kirche in Transkarpatien), islamische Gemeinden (Krimtartaren) und Judentum.
Durch den russischen Angriffskrieg habe es neue Versuche der politischen Einflussnahme gegeben. Eine zukunftsfähige Ostpolitik bestünde auch in einer Vernetzung mit kirchlichen und ökumenischen Akteuren “im Westen”, wie zum Beispiel mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK).
Ursachenforschung: zwei Fehleinschätzungen und “ein ganz großes Geschäft”
Um journalistische Beobachtungen mittel- und osteuropäischer Realitäten ging es im Gespräch von Roger de Weck mit Michael Thumann, dem außenpolitischen Korrespondenten der “Zeit”, der von Moskau aus per Zoom zugeschaltet war.
Auf die Frage: “Was ist schiefgelaufen?” in der Ostpolitik und Russlandpolitik, wies Thumann zunächst darauf hin, dass die deutsche Ostpolitik der 1960er und 1970er Jahre nicht aus heutiger Sicht verurteilt werden sollte. Sie habe ihre Verdienste gehabt und noch in den 1990er Jahren einen Grundstein für eine gute Zeit der Integration gelegt, die etwa die G8-Treffen oder auch das Nato-Russland-Abkommen. Jedoch könne man zwei Fehleinschätzungen und ein “ganz großes Geschäft” benennen, die neben anderen als Ursachen für die misslungene Entwicklung im Verhältnis zu Russland gesehen werden können.
Die erste Fehleinschätzung, so Thumann, betreffe die Person Wladimir Putin, der zu lange als “Der Deutsche im Kreml” (Alexander Rahr) gegolten habe, der auf deutscher Seite sowohl unterschätzt als auch schöngeredet wurde. Spätestens ab 2014, mit der Annexion der Krim, hätte man in Deutschland wissen können, mit wem man es zu tun hat.
Die zweite Fehleinschätzung betreffe die Devise “Wer Handel miteinander treibt, führt keine Kriege gegeneinander”, die von Willy Brandt vertreten wurde. Dieser Satz sei lange richtig gewesen, so Thumann, “ab 2014 war er aber falsch”. Grundlegende Konsequenzen seien daraus aber nicht gezogen worden.
Schließlich sei da noch als Grund “das ganz große Geschäft” – der Öl- und Gasimport aus Russland, der bereits in den 1970er Jahren begann und die letzten Endes zu einer Abhängigkeit von russischer Energie führte. Als Schlüsselfigur in der Zeit von 2014 bis 2021 könne Sigmar Gabriel gelten, so Thumann, der – gemeinsam mit Angela Merkel und Regierungsvertretenden – viele Warnungen in den Wind schlug. “Man war ganz furchtbar naiv und hörte vielen nicht zu, die damals sagten: ‘Passt auf!'”
Als “großen Wendepunkt” in der Entwicklung von Putin als russischem Staatsoberhaupt, nannte Thumann nicht die Rede Putins im Jahr 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz, sondern das Jahr 2012, als Putin wieder Präsident wurde und auf Medwedew folgte. Ab hier habe die Verwandlung Russlands in einen repressiven Staat begonnen, bis hin zu der “Diktatur mit totalitären Zügen”, die sie heute ist. Doch auch die russischen Bürgerinnen und Bürger trügen eine Mitschuld. “Die Leute haben sich kaufen lassen”, so Thumann. Für den wirtschaftlichen Aufschwung nahmen Sie eine Rücknahme ihrer Mitbestimmungs- und Freiheitsrechte in Kauf. Dass die russische Bevölkerung heute eher passiv auftrete hinge mit einer “Mischung aus Desillusionierung, Depolitisierung und großer Angst” zusammen.
Propagandamaschine “auf Hochtouren”
Der Samstagabend der Tagung bot Raum für die Perspektive eines russischstämmigen Kunst- und Kulturschaffenden. Unter der Titelzeile “In der heutigen Welt können wir nicht sagen: Wir sind einfach nur Musiker und spielen Musik” (ein Zitat Jurowskis) sprach die Radioredakteurin des Bayerischen Rundfunks Sybille Giel mit Vladimir Jurowski, dem Chefdirigent und Künstlerischen Leiter des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin sowie Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München. Jurowski wurde 1972 in Moskau geboren und hatte weltweite Arrangements, durch die er jahrelang nach Moskau und andere große Städte im Ausland pendelte. Seit nunmehr 30 Jahren lebt er in Deutschland. 2021 beendete er seine Arbeit als Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Staatlichen Akademischen Sinfonieorchesters Russlands (Swetlanow Sinfonieorchester). Im September 2017 hatte sein Engagement in Berlin begonnen, im Herbst 2021 übernahm Jurowski zudem als Nachfolger von Kirill Petrenko den Posten des Generalmusikdirektors der Bayerischen Staatsoper.
Seit dem Ausbruch des Krieges ist er nicht mehr in Russland gewesen, aber er berichtete auf der Tagung von dem, was er über russische Medien, Social Media, Freunde und Bekannte an Aktualität mitbekommt. “Die Propagandamaschine läuft im Moment auf Hochtouren”, sagte Jurowski. Das Land habe begonnen, sich von innen zu verschließen, jeden Tag würden Institutionen, Organisationen und Läden dichtmachen. Es sei wie ein Adventskalender – nur eben umgekehrt: Türen gingen zu statt auf. Es habe die Suche nach den Feinden von innen begonnen, etwas, das ihn an die 1930er Jahre in Deutschland oder an die 1950er in den USA erinnere. “Mir tut alles, was in Russland passiert, noch immer weh, obwohl ich seit 30 Jahren hier bin.”, sagte Jurowski, der an dem Abend am Revers einen Button mit den Farben der Ukraine trug.
Das kulturelle Leben in Russland sei über die vergangenen Monate hinweg verarmt, so Jurowski. Die staatliche Unterdrückung habe zuerst Journalist: innen getroffen, viel später erst Kunstschaffende – und hier vor allem Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Musiker und andere Künstler hätten lange relativ unbescholten arbeiten können, doch seit dem Ausbruch des Krieges sei das nun vorbei. An Theatern würden die Spielpläne extrem überwacht, Namen entfernt – in ganz Russland verschwänden Bücher aus Regalen. Der Missbrauch von Schriftstellerinnen und Schriftstellen in der sowjetischen und russischen Geschichte war ebenfalls Thema, Jurowski erzählte vom tragischen Leben Alexander Puschkins und davon, dass Leo Tolstoi hingegen verschont geblieben sei. Sein Buch “Krieg und Frieden” zählt für Jurowski zu den relevantesten und sei heute aktueller denn je.
Auch auf die Verbindung zwischen Wladimir Putin und Alexander Solschenizyn (“Der Archipel Gulag”) ging Jurowski ein. In den vergangenen Jahrzehnten habe sich Solschenizyn stark verwandelt, würde heute für russische Propaganda instrumentalisiert.
Politische Zeichen durch Musik setzen
Putin habe es geschafft, in den letzten 20 Jahren die Zivilgesellschaft zu brechen, sagte Jurowski. Es gäbe heute keine einzige öffentliche Figur, die die Widerstandsbewegung hinter sich versammeln könnte. Oppositionsbewegungen im Untergrund würden vor allem aus jüngeren Menschen bestehen. Seit der Mobilmachung würden nicht nur junge Männer zum Kriegsdienst eingezogen, er kenne auch Männer zwischen 45 und 55 Jahren, die nun an die Front abgezogen wurden.
Jurowski erzählte auch die Geschichte der russischen Staatshymne und die Geschichtspolitik Russlands, die damit einhergeht. Im Jahre 1999 habe Putin wieder die alte Hymne der Sowjetunion eingeführt – nur den Text habe er umschreiben lassen.
Ein besonderer Moment sei für ihn das Konzert am 26. Februar 2022 gewesen, zwei Tage nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Auf dem Programm des Rundfunksymphonieorchesters hätten russische Kompositionen gestanden – Jurowski beschloss, auf den Kriegsausbruch musikalisch zu reagieren. Im Konzerthaus Berlin spielte er von Mychaljlo Werbyzkyj die Nationalhymne der Ukraine (Sinfonische Ouvertüre Nr.1) statt dem ursprünglich geplanten Marsch von Tschaikowski, von Anton Rubinstein das Konzert für Violoncello und Orchester Nr.2, von Pjotr Tschaikowsky die Sinfonie Nr. 5 e-Moll und von Dmitri Smirnow das Concerto piccolo für Violoncello und Orchester in der Uraufführung. Jurowski beschrieb das Werk von Smirnow, der 2020 an den Folgen von Covid-19 starb, als eine “Geschichte Russlands in vier Hymnen”. Das Orchester fühle und fühlt sich als Teil der Geschichte, so Jurowski und fügte hinzu: “Die Naivität ist uns für immer genommen.”
“Kollektive Realitätsverweigerung”
In seinem Vortrag “Abschied von der Versorgungssicherheit” ging als nächstes Dr. Frank Umbach, Forschungsleiter des Europäischen Cluster für Klima-, Energie- und Ressourcensicherheit (EUCERS), Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (CASSIS) an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn auf die aktuelle Entwicklung ein. Auch Umbach äußerte sich kritisch zur “Zeitenwende”. Der Begriff suggeriere Änderung – jedoch die Welt habe sich nicht geändert, sondern es seien Fehleinschätzungen gemacht worden, die Umbach als “kollektive Realitätsverweigerung” betitelte.
Ein Schlüsseljahr sei 2005 gewesen, als der Beschluss zum Bau der Nordstream2-Pipeline gefällt wurde. Zugleich war es das Jahr der Orangenen Revolution in der Ukraine. Innen- und Außenpolitik ließen sich nicht voneinander trennen, wenn ein Staat autoritärer wird, dann habe das immer auch Auswirkungen auf die Außenpolitik.
Er kritisierte, dass Deutschland sich offenbar nie darüber Gedanken gemacht zu haben scheint, wie die deutsche Politik im Ausland wahrgenommen wird. Eine “Kommunikation der Anreize” werde von totalitären Regimes wie das in Russland als Schwäche wahrgenommen, nicht als Anreizangebot. Eine politische Kommunikationsstrategie mit totalitären Regimes sollte eher der Devise “Abschreckung durch Konsequenzen” folgen. Durch die Energiepolitik der vergangenen Jahre seien asymmetrische Abhängigkeiten von Russland entstanden.
Darüber hinaus sei es ein Fehler gewesen Wirtschaftspolitik von Außenpolitik zu trennen. Wie soll ein Staat Energieversorgungssicherheit gewährleisten, wenn er sich nicht in Energiepolitik einmischt? Erst mit dem Ausbrechen der Konflikte in der Ukraine 2007 habe sich diese Sichtweise geändert.
Hinzu kommt laut Umbach, dass Deutschland den “Ressourcennationalismus” verschlafen habe. Früher habe es weltweit deutsche Beteiligungen an Rohstoffminen weltweit gegeben, die deutschen Unternehmen seien hier allerdings “herausgepresst” worden – eine strategische Fehlentscheidung, die nicht mehr rückgängig zu machen ist.
In einer Übersicht stellte Umbach das Energie-Trilemma vor: die drei Ziele und Determinanten von Energiesicherheit: “Moskau” beschreibt die Versorgungssicherheit, “Kyoto” Nachhaltigkeitsziele, Umwelt- und Klimaschutz und “Lissabon” wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Die Herausforderung sei, ein Gleichgewicht zwischen den drei Zielen zu bewahren und nicht ein Ziel zulasten der beiden anderen zu bevorzugen. Zusätzlich wirkten auf diese drei Determinanten Industrie- und Technologiepolitik bei Erneuerbaren Energien und öffentliche Akzeptanz. Auch habe in der Vergangenheit die deutsche Energiepolitik den Leitlinien der EU widersprochen. Die Entscheidung für Nordstream etwa sei von den europäischen Nachbarstaaten als rücksichtsloses Verhalten Deutschlands wahrgenommen worden.
Mit der Energiepolitik der Merkel-Regierung ging Umbach hart ins Gericht. Das Gebot des politischen Konsenses habe Merkel als “Konzept” verstanden und ihr Land als größten Mitgliedsstaat der EU Alleingänge machen lassen. Umbach plädierte hier für ein neues vernetztes Denken unter Berücksichtigung der eigenen Führungsrolle Deutschlands innerhalb der EU.
Wie sieht unser “sicherheitspolitischer Ideenhaushalt” aus?
Der letzte Themenaspekt der Tagung berührte den Krieg Russlands in der Ukraine hinsichtlich seiner Folgen für die Sicherheitspolitik. Dazu sprach der Jurist und Ökonom Michael Rühle, Leiter des Planungsreferats in der Politischen Abteilung der Nato in Brüssel.
Der Angriff Russlands habe in Deutschland und innerhalb Europas einen Schock ausgelöst. Bundeskanzler Olaf Scholz habe die außergewöhnliche Situation erkannt und außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen: unter dem Begriff “Zeitenwende” habe er auch eine Erhöhung des Militäretats und Waffenlieferungen an die Ukraine beschlossen.
Die Zeitenwende habe gezeigt: “Wir sind mehr und können mehr als bloße Zivilmacht zu sein.” Unter der Oberfläche habe die Zeitenwende aber zahlreiche strukturelle Probleme der Sicherheitspolitik zum Vorschein gebracht: die jahrelange Vernachlässigung der Bundeswehr, eine weitgehend sich auf das Symbolische beschränkende Sicherheitspolitik, Parlamentsvorbehalte und Probleme hinsichtlich des “sicherheitspolitischen Ideenhaushalts”, so Rühle. Diesen Punkten müsse aktiv begegnet werden. Er plädierte für eine deutsche Sicherheitspolitik, die weiterhin transatlantisch bleibt, personelle und finanzielle Investitionen in die Bundeswehr und hinsichtlich des Ideenhaushalts eine Debatte, die sich “an außenpolitischen Realitäten orientiert.”
In seinem Tagungsfazit ging der Leiter des Politischen Clubs, Roger de Weck, auf drei Aspekte ein. Zum einen habe die Tagung gezeigt, dass es sinnvoll ist, die deutsche Politik im Wechselspiel zwischen Fremdbild und Eigenbild zu betrachten – aktiv andere Perspektiven einzunehmen. “Wir sollten mehr auf Osteuropa hören”, sagte de Weck und wies darauf hin, dass das nicht unbedingt bedeute, dem automatisch zuzustimmen, sondern es ginge schlichtweg um das Zuhören und Ernstnehmen. Man müsse versuchen, die drei Kulturen in Europa zu vereinen: die lateinische, germanische und slawische. Regieren heiße antizipieren – durch das Zuhören könne dem Rechnung getragen werden.
Ein letztes Plädoyer galt den Institutionen auf europäischer und internationaler Ebene. Europäisches Parlament, Europarat und Nato seien dafür da, dass ein “Dauergespräch” zwischen den unterschiedlichsten Interessengruppen stattfinde, dass Menschen miteinander sprechen müssen, die aus eigenem Antrieb nicht miteinander reden würden. Dieses Wechselspiel zwischen Institutionen und Kultur sei ein “großer zivilatorischer Fortschritt”.
Dorothea Grass
Eine Auswahl mit Bildern der Tagung haben wir hier für Sie zusammengestellt.
Bild: Roger de Weck (links) mit Janusz Reiter (von 1990 bis 1995 Botschafter von Polen in Deutschland), der den Eröffnungsvortrag hielt. (Foto: Haist/ eat archiv)