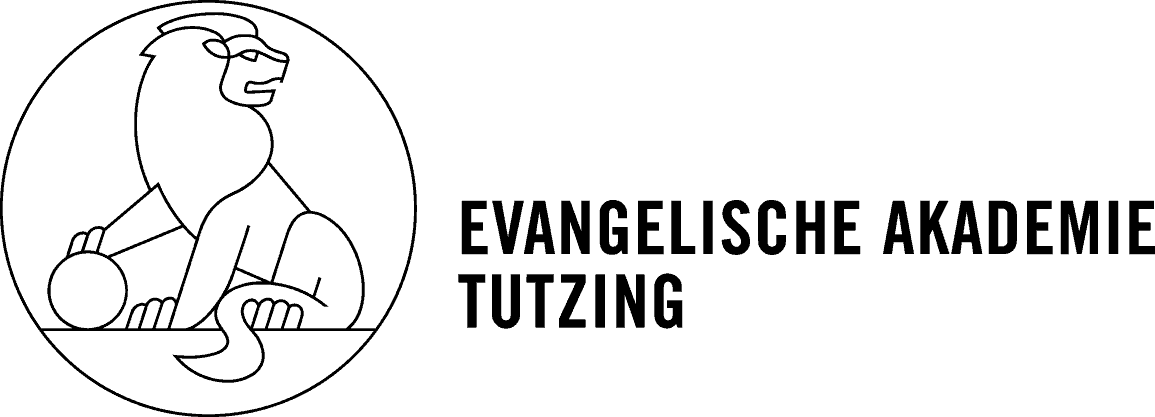70 Jahre Grundgesetz – Was ist unsere Verfassung wert?
Ausführlicher Bericht zur Sommertagung des Politischen Clubs der Evangelischen Akademie Tutzing vom 21. bis 23. Juni 2019
„Wie die Bundesrepublik wird in diesem Jahr auch deren konstitutionelles Fundament, das Grundgesetz, 70 Jahre alt. Seit fast 30 Jahren ist es auch die gemeinsame Verfassung des wiedervereinigten Deutschlands. So sehr das Grundgesetz als vorläufig gedacht war, so sehr ist es inzwischen längst zum Rückgrat eines ziemlich lebendigen und stabilen Staatskörpers geworden.
In seiner Begrüßung zur Tagung bezeichnet Dr. Wolfgang Thierse, Leiter des Politischen Clubs und früherer Bundestagspräsident, das deutsche Grundgesetz als „Rückgrat eines stabilen und lebendigen Staatskörpers“. In Anspielung auf den nahenden 30. Jahrestag des Berliner Mauerfalls und die Wiedervereinigung im Jahr 1990 fügt er hinzu, dass es auch das Grundgesetz der BRD ein Faktor für DDR-Bürger gewesen sei, zur BRD gehören zu wollen.
Das Grundgesetz entstand in Anknüpfung an die Weimarer Verfassung – jedoch es lernte zugleich aus der Geschichte. Thierse betont, dass das Grundgesetz als ein Provisorium gedacht war, als ein „antitotalitärer Entwurf“.
Heute gilt das Deutsche Grundgesetz nach wie vor – wenngleich es in seiner 70-jährigen Geschichte mittlerweile das Doppelte an Umfang erreicht hat. Insgesamt 63 Änderungen zählt es heute. Auch um diese soll es während dieser Tagung gehen, sowie um die Änderungen, die es noch geben wird oder die, die als nötig erachtet werden. Dazu später mehr.
Die Zeit der Entstehung
In seiner Lesung „1949. Demokratie ohne Demokraten?“ holt der Autor Christian Bommarius seine Leser und Zuhörer zurück in die Zeit der Entstehung des Deutschen Grundgesetzes und macht sie anhand von Momentaufnahmen und Episoden deutlich. Bommarius ist Autor des Buches „1949. Das lange deutsche Jahr“, 2018 im Droemer Verlag erschienen. Er zeichnet in seinem Vortrag in Tutzing ein überwiegend düsteres Bild des Nachkriegsdeutschlands. Bommarius berichtet von Thomas Manns Rückkehr nach Deutschland. Anlass seines ersten Deutschlandbesuchs seit seiner Emigration im Jahr 1933 ist die Verleihung des Goethepreises der Stadt Frankfurt am Main am 25. Juli 1949 an den Literaturnobelpreisträger. Mann selbst hatte offenbar keine Lust auf den Besuch, er hatte Morddrohungen erhalten und in seinem Tagebuch schrieb er, er „ziehe in den Krieg“. Manns Besuch sowie die Preisverleihung an ihn sind in der Öffentlichkeit umstritten. Bommarius spielt auf die Debatte an, die als „Große Kontroverse“ bekannt wurde und von dem Autoren Frank Thiess in der Münchener Zeitung vom 18. August 1945 beschrieben wurde. Dabei geht es um die Haltung der deutschen Literaturschaffenden gegenüber dem NS-Regime: Wie moralisch waren die vielfachen Fluchten ins Ausland („äußere Emigration“) gegenüber dem inneren Standhalten gegenüber den Nazis, also der „inneren Emigration“? Gemäß seinen Aufzeichnungen rechnete Mann 1949 mit einer Renazifizierung der Deutschen. In einem Lagebericht schreibt der amerikanische Journalist Russel Jones zu dieser Zeit Ähnliches, so unterstützen die USA das Nachkriegsdeutschland nicht etwa aus „Nächstenliebe“, sondern aus der Hoffnung heraus, Deutschland als Bollwerk gegen den Bolschewismus zu etablieren.
Zur Stimmungslage in Deutschland 1949 zitiert Bommarius aus einer damaligen Umfrage. Demnach 60 Prozent lehnten den Staat ab; 53 Prozent der Deutschen waren Antisemiten und 64 Prozent dafür, dass Homosexualität für immer verboten bleiben solle. Auf Nachfrage sagt Bommarius, die Wahl demokratischer Parteien (CDU, SPD, FDP) sei dadurch begründet gewesen, dass sich die damaligen Parteien sehr nationalistisch verhielten. Zitat: „Adenauer war teilweise schlimmer als Gauland.“
Wolfgang Thierse bringt den Beitrag von Bommarius mit diesem Schlusssatz auf den Punkt: „Das eigentliche Wunder (im Nachkriegsdeutschland, Anm. d. Red.) war nicht das Wunder von Bern, sondern das Wunder des Grundgesetzes.“
Die Frage nach der Rolle und Haltung der Evangelischen Kirche
Der Theologe und Ethiker Prof. Dr. Hans-Richard Reuter blickt in seinem Vortrag „Der deutsche Protestantismus und die Demokratie des Grundgesetzes“ auf das ambivalente Verhältnis der Evangelischen Kirche in Deutschland zu Demokratie und Grundgesetz zurück. Insbesondere in den Nachkriegsjahren habe es eine weit verbreitete Demokratieskepsis der Evangelischen Kirche gegeben. Dieses Verhältnis hat sich in den vergangenen 70 Jahren stark gewandelt: Heute tritt die Evangelische Kirche sehr stark für die Demokratie ein.
In seinem Abriss über diese Geschichte erinnert Reuter daran, dass viele deutsche Präsidenten Protestanten waren oder sind – selbstverständlich sei das aber nicht gewesen. Das Luthertum habe sich lange mit der Demokratie schwergetan. Gründe dafür lagen im „Übergang zum landesherrlichen Kirchenregiment zu einer besonders engen Bindung der evangelischen Kirchen an die Obrigkeit.“ Auch die Französische Revolution habe mit ihren Ideen von Atheismus und den gewaltsamen Folgen der Revolution dafür gesorgt, dass Demokratie unter Protestanten als inakzeptabel galt.
Reuter beschreibt in der Entwicklung bis heute drei Phasen: Demokratieskepsis, Demokratiebefreundung und Demokratieförderung.
In Phase eins, der Demokratieskepsis, galten beide großen Kirchen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg als Demokratiegarant. Beide lehnten Totalitarismus ab. Während der Zeit des Dritten Reiches hatte sich die Bekennende Kirche gegründet, sie verfolgte jedoch andere Ziele, etwa gegen die Gleichschaltung der Kirche in der Diktatur. Karl Barth, der Mentor der Bekennenden Kirche, empfand Demokratie nicht als Bedrohung. Barth erkannte die weltliche Demokratie mit der Idee der Volkssouveränität und der weltanschaulichen Neutralität des Staates an. Er sympathisierte mit der direkten Demokratie.
Das Luthertum hingegen sah Demokratie als Teil des Verfalls an, die mit Aufklärung und Französischer Revolution begonnen hatte. Otto Dibelius, von 1949-1961 Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, hegte große Zweifel gegenüber der Demokratie.
Insgesamt war die EKD nach dem Zweiten Weltkrieg noch schwach. Ihre Organisationsstruktur war während der NS-Zeit zerstört worden. Ihre Ziele waren denen der katholischen Kirche ähnlich. Drei Forderungen stellten die Kirchen: 1. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, 2. die verfassungsrechtliche Stellung der Kirchen in der neuen Demokratie und 3. das elterliche Erziehungsrecht und die Schulpolitik. Zum letztgenannten Punkt: Die evangelische Kirche verstand den alleinigen Auftrag zur Erziehung vonseiten des Staates als „Ausdruck einer totalitären Staatsauffassung“.
„Der Säkularität des liberalen Rechtsstaats und der pluralistischen Demokratie standen die damaligen Kirchenvertreter verständnislos gegenüber“, so Reuter.
In Phase zwei, der Phase der Demokratiebefreundung, spielte die Normalität des Alltags in der neu gegründeten BRD eine Rolle: der Sozialstaat entwickelte sich, die Menschenrechte wurden verteidigt, wirtschaftlicher Fortschritt hielt Einzug und es entwickelte sich eine evangelische Zivilgesellschaft. Der deutsche Protestantismus entwickelt sich zu einem „Faktor demokratischer Mitgestaltung“, so Reuter. Doch erst 1985 sollte es zu Klärung des Demokratieverständnisses kommen. In der von der EKD-Kammer für öffentliche Verantwortung ausgearbeiteten Denkschrift zum Thema „Evangelische Kirche und freiheitliche Verantwortung“ erklärte die EKD ihr positives Verhältnis zum Staat des Grundgesetzes, in dem sie die „förmliche Aneignung des Gegebenen unter den eigenen christlichen Prämissen“ postulierte.
(Im Vergleich dazu war die Haltung der evangelischen Kirche in der DDR zum Staat eine andere bzw. waren die evangelischen Kirchen in der DDR darüber völlig uneins. „staatskritische Freiwilligkeitskirche“)
Vier Punkte waren für die Zustimmung zur Demokratie seitens der Protestanten entscheidend: das Prinzip der Menschenwürde, die Anerkennung der Freiheit und Gleichheit aller Menschen, die Annahme der Fehlbarkeit des Menschen sowie der alltägliche Dienst am Nächsten als Parallele zur Begrenzung der Macht der Politiker. Insgesamt ließ sich daraus die Zustimmung zu elementaren Prinzipien des Grundgesetzes ableiten, wie die Rechtstaatlichkeit, Grundrechte, Gewaltenteilung sowie das Repräsentations- und Mehrheitsprinzip.
Reuter weist zudem auf den historischen Kontext hin: auf die neuen Formen von Partizipation, wie sie sich seit den 1970-er Jahren etablierten. Er erinnert etwa an das Engagement der Theologen Dorothee Sölle und Helmut Gollwitzer, gemeinsam mit dem Schriftsteller Heinrich Böll und anderen gegen die Stationierung der Pershing-Raketen auf dem US-Stützpunkt im schwäbischen Mutlangen im Jahr 1983.
Die dritte Phase der Demokratieförderung begann mit der deutschen Wiedervereinigung. Die evangelische Kirche suchte nach einer gemeinsamen Haltung zur anlaufenden Verfassungsdiskussion, unter gesamtdeutschen Bedingungen. Der Rat der EKD berief daraufhin eine Fachgruppe unter dem Vorsitz des ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidenten Ernst Benda ein. 1991 erschien der so genannten „Ratschlag zur Verfassungsdebatte“, der allerdings kaum Beachtung fand. Darin stand, die Kirche solle „mithelfen, den Bürgern die bewährten demokratischen, föderalistischen, Rechts- und sozialstaatlichen Strukturen nahezubringen.“ Etwaige Verfassungsreformen sollten auch Anfragen von früheren DDR-Bürgern abbilden. Das Papier empfahl zudem eine Volksabstimmung, durch die das Volk Gelegenheit erhalten sollte, sich mit der „Verfassung des neuen Gesamtstaats zu identifizieren.“
Ein weiterer Entwurf kam vom späteren Bündnis 90-Abgeordneten Wolfgang Ullmann, der ein „Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder“ vorschlug. Die Rasanz der Entwicklung im deutschen Einigungsprozess liefen diesen Empfehlungen dagegen. Die Gemeinsame Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat in Fragen des Staat-Kirche-Verhältnisses sah hier „mehrheitlich keinen Handlungsbedarf“.
Mit der deutschen Einigung, so Reuter, sei die Bundesrepublik „bekanntlich nicht protestantischer, sondern säkularer und auf Dauer religiös pluraler geworden“. Heute gehöre der Protestantismus zu den „entschiedensten Verteidigern der grundgesetzlichen Ordnung“, sagt Reuter. Dabei seien drei Typen politischer Anliegen und Forderungen der Kirche zu unterscheiden: sozialethische Postulate, Wertorientierungen und Eigeninteressen. Ersteres entstehe aus der Konsequenz, sich als „Kirche für andere“ zu sehen, gesamtgesellschaftliche Probleme anzugehen und universalistische Ziele zu verfolgen wie Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Anliegen aus dem Bereich der Wertorientierungen seien beispielsweise Wortmeldungen zu Bio- oder Medizinethik, zur Abtreibungsdebatte, Sterbehilfe oder Reproduktionsmedizin. Natürlich gebe es auch organisationsspezifische Eigeninteressen, doch habe in diesem Punkt in den vergangenen Jahren eine demokratiekompatible Umakzentuierung stattgefunden, etwa was das Thema Religionsunterricht betreffe. Hier sei man weg gekommen vom weltanschaulichen Anliegen und hin zur Motivation der Bildung als solche.
Abschließend erinnert Reuter daran, dass der Rat der EKD und die Deutsche Bischofskonferenz anlässlich der Verfassungsgebungen vor 70 und 100 Jahren gerade erst ein gemeinsames Wort veröffentlichten, in dem sie postulierten, das „Vertrauen in die Demokratie stärken“ zu wollen und für die Problemlösungsfähigkeit demokratischen Regierens zu werben.
Garant der demokratischen Stabilität
In seinem Vortrag „Das Bundesverfassungsgericht als Garant der demokratischen Stabilität der Bundesrepublik“ greift der Präsident des Bundesverfassungsgerichts a.D., Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, den Stabilisierungsaspekt für die Gesellschaft auf. Er ruft in Erinnerung, dass es noch nie zuvor auf deutschem Boden eine so lange Zeit der staatlichen Stabilität gegeben habe. Die aktuellen Herausforderungen der digitalisierten und globalisierten Welt jedoch setzen auch die Verfassung unter großen Anpassungs- und Veränderungsdruck. Da es die Verfassung ist, die den verbindlichen Handlungsrahmen vorgibt, steht das Grundgesetz nach der Ansicht Papiers von einer Bewährungsprobe. „Eines gilt: Auch bewährte Verfassungen müssen sich immer fragen lassen, ob sie vor den Herausforderungen Bestand haben können“, so der Staatsrechtswissenschaftler. Der Balanceakt besteht für Verfassungsrichter darin, weder dem Zeitgeist zu huldigen noch sich zu weit von der Lebenswirklichkeit der Bürger zu entfernen.
Das Deutsche Grundgesetz ist aus der Weimarer Reichsverfassung hervorgegangen. Eines fällt auf: Es trägt nicht den Namen „Verfassung“. Die Bezeichnung war bewusst umgangen worden, um dem provisorischen Charakter der Verfassung Ausdruck zu verleihen, denn sie war vorerst ja nur für einen Teil Deutschlands gültig.
Heute, so Papier, ist dieser Aspekt längst durch die Wirklichkeit eingeholt worden, stellt nur noch eine semantische Frage dar. Längst ist das Grundgesetz aus dem Stadium des Provisorischen hinausgewachsen!
Trotz fehlender Volksabstimmung über das „Provisorium“ Grundgesetz sieht Papier keine Notwendigkeit für eine solche Abstimmung, denn die Akzeptanz für die Verfassung werde durch die Wahlerfolge von verfassungsfreundlichen Parteien deutlich.
Als markantesten Unterschied zur Weimarer Verfassung nennt Papier, dass die Grundrechte einklagbar sind. Von dieser Möglichkeit wird rege Gebrauch gemacht: pro Jahr gibt es etwa 6000 Verfassungsbeschwerden.
„Die Normativität und Justiziabilität der Grundrechte ersetzen die vormalige Programmhaftigkeit der Grundrechte“, so Papier. Das Verfassungsgericht versucht vor allem mit den Mitteln der Konkretisierung und Fortbildung den Veränderungen in der Gesellschaft Rechnung zu tragen, so zum Beispiel beim Grundrecht auf freie Persönlichkeitsentfaltung und Selbstbestimmung. Dabei ist die Herausforderung erneut die Balance – hier zwischen Freiheit des Einzelnen und Sicherheit der Bevölkerung. Im Zweifelsfall wird zugunsten der Sicherheit entschieden.
Ein weiterer wichtiger Punkt als Garant der demokratischen Stabilität ist, dass der Rechtstaat seine Gegner alleine mit den Mitteln des Rechtstaats bekämpft. Für diesen haben Grundrecht wie die Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit besondere Bedeutung. Die Grundrechte sind außerdem dafür da, die Rechte des Einzelnen gegen staatliche Übergriffe zu sichern. In der digitalisierten Welt gewinnt dieser Aspekt an Bedeutung. Papier betont: „Nicht alles, was technisch möglich ist, ist verfassungsrechtlich erlaubt!“ Er verteidigt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, auf dem etwa die Datenschutzgrundverordnung fußt. Damit soll etwa verhindert werden, dass private Daten, die gespeichert und ausgewertet werden, nicht mehr für den Einzelnen nachvollziehbar sind.
Darin begründet liegt auch die Verfassungswidrigkeit einer flächendeckenden Telekommunikationsdatenspeicherung.
Im Gegensatz zu den Grundrechten enthält das Grundgesetz keine allgemeinen Aussagen zu Grundpflichten des Einzelnen bis auf eine Ausnahme: Eigentum verpflichtet.
Das Grundgesetz geht demnach nicht nur von Freiheit und Selbstbestimmung aus, sondern auch von dem Prinzip der Eigenverantwortung.
Der Staat, für den das Grundgesetz steht, ist zwar ein Sozialstaat, der den Menschen die Risiken abnimmt, die sie nicht selbst schultern können, gleichwohl darf der Rechtsstaat gemäß Papier nicht zum Vollversicherer aller Privatrisiken werden. „Freiheit und Verantwortung stehen im untrennbaren Komplementärverhältnis“, sagt Papier.
Ein weiterer Punkt ist, dass der Gesetzgeber der „Erstinterpret der Verfassung“ ist. Dieser jedoch ist nicht langfristig ausgerichtet – die Wahlperioden dauern jeweils vier Jahre, Wahlkampf ist jedoch immer in einer Region, weil die Landtagswahlen von der Bundesebene unabhängig sind. Relativ deutliche Kritik übt er daher an der aktuellen Politik: Das Verfassungspotential wird häufig nicht genutzt. Papier beklagt „Kurzatmigkeit“, „Dauer-Wahlkampf“, „politischen Aktionismus“ und „ständiges Wechseln von Themen“, die die Verfassung aufblähen. Gesetzesforderungen wie etwa das Recht auf bezahlbares Wohnen gehen seiner Meinung nach völlig am eigentlichen Auftrag vorbei.
Er appelliert an nachhaltigere und dauerhaftere Politik (evtl. GG-Ergänzung hierzu). Papier sagt: „Der eigentliche Sinn des Staates ist die Freiheit“ – in Verantwortung für sich selbst und die Menschen.
Papier zitiert an dieser Stelle das Böckenförde-Diktum und dessen Konklusion:
„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Anderseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter Ebene – in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat.“
Papier wehrt sich gegen Forderungen nach einer neuen Verfassung für Deutschland – und auch gegen ein Aufblähen des Grundgesetzes. Er verteidigt die Judikative als Hüter der Verfassung, insbesondere der Grundrechte. Sie ist essentiell, denn: „Auch Mehrheiten können unsägliches Unrecht begehen.“ Gleichzeitig müsse verhindert werden, so Papier, dass die Verfassungsgerichtbarkeit eigene politische Machtinteressen verfolgt.
Veränderungen
Das Grundgesetz hat in den vergangenen 70 Jahren seinen Umfang verdoppelt. Welche Geschichte das Grundgesetz durchlaufen hat, zeigt Prof. Dr. Horst Dreier in seinem Vortrag „Das Grundgesetz im Spiegel seiner Veränderungen“ nach.
Er beschreibt die Verfassung als ein „learning document“. Die drei groben Eckpfeiler in der Geschichte des Grundgesetzes sind: Provisorium, Transitorium, Wiedervereinigung (nach Artikel 23 GG).
Doch was sind eigentlich genau die Verfassungsänderungen? Charakteristisch ist, dass die Verfassung bei jeder Änderung nicht direkt verändert wird, sondern im Prinzip erweitert. Dreier beschreibt das mit der „Revision des Normbestandes ohne Auswechslung der Identität“. In seinem Vortrag widmet er sich den großen Eckdaten, was er mit Absicht auslässt, ist der „stumme Verfassungswandel“ (Begriffe, die in der Verfassung auftauchen, aber in der heutigen Zeit gegenstandslos geworden sind.)
Seine Chronologie der wichtigsten Änderungen des Grundgesetzes unterteilt er in sechs Phasen.
Phase eins nennt Dreier die Verfassungsnachholung. Sie beinhaltet die Wehrverfassung von 1959 (als erste große Änderung) und die Notstandsverfassung von 1968.
Beide hatten gesellschaftlich heftige Auswirkungen, wurden extrem kontrovers diskutiert. „FridaysforFuture ist dagegen ein laues Lüftchen.“, so Dreier.
Phase zwei ist demnach die Verfassungskorrektur. Sie äußerte sich vor allem in der Finanzreform von 1969. Die dritte Phase bezeichnet Dreier als Verfassungsbewährung – sie manifestierte sich in der Deutschen Wiedervereinigung von 1990. Dreier präzisiert: Die DDR ist dem Grundgesetz nicht beigetreten, sondern hat lediglich einen – jedoch exzellenten – Einigungsvertrag unterzeichnet.
Die Verfassungsänderung zur Europäischen Integration 1992 stellt die vierte Phase dar, die der Verfassungstranszendierung. In Phase fünf kam es 1993 (art. 16) und 1998 (Art. 13) zu Grundrechtsrestriktionen. Sechste und letzte Phase stellen die Föderalismusreformen I und II (2006 und 2009)
Dreier sieht die Geschichte der Veränderungen kritisch. Sein Befund lautet: die Änderungen weisen eine Tendenz zur Redseligkeit und Kleinteiligkeit auf. Er kritisiert die Überfrachtung und Detailfreude vieler Grundgesetz-Änderungen. Beispiel: Die Versiebzigfachung des Asylartikels (1993). Dreier kritisiert auch neue, vereinfachte Gesetzesnamen wie etwa das ,Gute-Kita-Gesetz‘. Provokant schiebt er hinterher: „Ich warte auf das ,Gute-Laune-Gesetz‘.“
Doch warum gibt es so viele Änderungen? Als Grund sieht Dreier das leichte Procedere: Das GG ist leicht und einfach zu ändern. Im Gegensatz zu den „normalen“ Gesetzen, sei nur eine Zwei-Drittel-Mehrheit vonnöten, um eine Änderung zu bewirken. Eine Volksabstimmung wie in Bayern sieht sie jedoch nicht vor. Dies führt möglicherweise zu mangelndem politischem Bewusstsein für eine qualitative Differenz zwischen dem Grundgesetz und normalen Gesetzen.
Dreier mahnt – wie auch Papier – den Gesetzgeber zu einem achtsameren Umgang mit der Verfassung – diese dürfe nicht temporäre 2/3-Mehrheiten widerspiegeln.
Er spricht den Wunsch aus, den Parteien die Macht der Verfassungsänderung zu entziehen und dies ausschließlich durch Volksabstimmungen nach bayerischem Vorbild zu ermöglichen
Das Grundgesetz als Leitkultur?
„Reichen die normativen Werte des Grundgesetzes für ein gelingendes Zusammenleben?“, hatte Wolfgang Thierse zu Eingang der Tagung gefragt. Auf diesen Punkt geht Prof. Dr. Tine Stein mit ihrem Vortrag „Das Grundgesetz als Leitkultur?“ ein. Prof. Dr. Tine Stein kommt direkt vom Kirchentag in Dortmund zur Tagung nach Tutzing. Das Thema „Vertrauen“ des Kirchentags begleitet sie aber dennoch weiter. Sie fragt: Wie groß ist das Vertrauen in die Demokratie? Welche Rolle spielt dabei das Grundgesetz? Kann es gar als „Leitkultur“ herhalten, wie es schon viele Male angesprochen wurde?
Sie beginnt ihren Vortrag mit dem Paradoxon, dass sich beide Themenkomplexe „Leitkultur“ und „persönliche Freiheit“, wie sie im Grundgesetz verankert ist, im Prinzip widersprechen. Die liberale Seite der Politik und Gesellschaft sieht dieses Paradoxon als unauflösbar an und bezeichnet es als „illiberale Zumutung“. Die Mehrheitsgesellschaft hingegen verteidigt das Prinzip als Orientierung für eine Gesellschaft, vor allem für die, die neu zu dieser hinzustoßen.
Eigentlich, so Stein, könne eine Verfassung nicht als Leitkultur dienen, aber: Eine liberale Verfassung braucht demokratische Bürger! Sie widmet sich zunächst einer Begriffsklärung. Was bedeuten Leitkultur und Verfassungspatriotismus? Meist werden beide Begriffe als miteinander konkurrierend wahrgenommen. Jedoch: Sie hängen eng zusammen.
Beide sind Konzepte der politischen Integration, die sich an alle richtet. Damit sie gelingen, sind Institutionen und Bürger gefordert. Stein selbst plädiert für ein weiteres Konzept: das der demokratischen Sittlichkeit.
Doch zunächst soll es um die Begriffsklärung gehen. Der Begriff Verfassungspatriotismus geht auf Dolf Sternberger zurück. Später wurde er von wurde später von Richard von Weizsäcker, Jürgen Habermas und anderen Politikern und Politikwissenschaftlern aufgegriffen. Nach Sternberger verbindet Verfassungspatriotismus die Liebe zum Vaterland mit der Liebe zur Verfassung als politische Ordnung der Freiheit. Sternberger wollte den Begriff einer chauvinistischen Tradition entreißen. Demnach war der Begriff des Vaterlands in einem Ethos der Bürger verwurzelt (Cicero). Das Vaterland wird in diesem Sinne als die Republik verstanden, die sich die Bürger erschaffen.
(Wikipedia: „Verfassungspatriotismus baut auf einem republikanischen Nationsverständnis auf. Dieses geht davon aus, dass die Nation eine durch gemeinsamen Willen und eine gemeinsame Geschichte zusammengehaltene Gemeinschaft von Menschen sei. Diese sehen sich untereinander als frei und gleich an.“) Jürgen Habermas entwickelte den Begriff weiter und appellierte zur Bindung an die universalistischen Prinzipien der Verfassung. Seine Auffassung: Der Bürger ist nicht nur Adressat des Rechts, sondern auch sein Autor!
Vor diesem Hintergrund bringt Stein das Diktum von Ernst-Wolfgang Böckenförde aus den 1960er Jahren an, der als Katholik und Sozialdemokrat besonders den Katholiken eine Brücke bauen wollte, die damals den Rechtstaat ablehnten. Böckenförde formulierte zwar den Widerspruch “Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.”, aber er machte auch seine Loyalität zum Rechtstaat deutlich, weil dieser gemeinwohlorientiert ist. Die Verfassung habe einen solidarischen Nutzen. Um solidarisch handeln zu können, benötige der Staat einen Grundkonsens an gemeinsamen Vorstellungen seiner Bürger. Die Erfahrung eines friedlichen Konfliktaustauschs stelle gleichwohl ein integratives Moment dar.
Stein bringt hier an, dass sie dafür ist, dass es neben dem Nationalfeiertag in Deutschland auch ein Haus der Verfassung geben sollte, um seiner integrativen Stellung auch öffentlichkeitswirksam Bedeutung zu verleihen.
Zum Begriff Leitkultur: Die Wahrnehmung und Debatte um diesen Begriff hat sich seit seiner Einführung gewandelt und ist abhängig vom Kontext zu sehen.
Eingeführt wurde der Begriff 1996 von dem Politologen Bassam Tibi. Er beschrieb darin den gesellschaftlichen Konsens zu europäischen bzw. westlichen Wertvorstellungen wie Demokratie, Menschenrechte, Zivilgesellschaft, Aufklärung und Laizismus. Er richtete sich darin insbesondere an eingewanderte Muslime und war integrationsmotiviert.
Später wurde der Begriff als politischer Kampfbegriff verwendet – man erinnere sich an die Rede des CDU-Abgeordneten Friedrich Merz im Jahr 2000. Er prägte den Charakter des Begriffs als Gegenentwurf zum Multikulturalismus – was nicht die Intention Bassam Tibis war.
Die Politikwissenschaftlerin Stein fasst die Problematik des Begriffs darin zusammen, dass in ihm oft die Ober-/ oder auch Unterordnung verschiedener Gruppen mitschwinge. Nach Habermas ist der Begriff Leitkultur nicht mit einer liberalen Verfassung vereinbar. Die Integration und das Einleben muss nicht in die Mehrheitskultur erfolgen, sondern in eine politische Kultur.
Um diese Dichotomie aufzulösen plädiert Tine Stein für eine politische Kultur der demokratischen Sittlichkeit. Wer denkt, dass Demokratie eine Mehrheitsgesellschaft bedeutet, erliegt einem Missverständnis! Alle politischen Gruppen seien gleichzusetzen.
Die Werte, die für ein demokratisches Überleben notwendig sind – Gemeinsinn, Toleranz, Solidarität, Kompromissfähigkeit, Orientierung an Wahrheit –, kann man nicht erzwingen. Der Staat kann nicht vorschreiben, wie Menschen sich zu verhalten haben. Nach Böckenförde jedoch ist ein Ethos dringend notwendig, dass die „inneren Regulierungskräfte“ des Staates aktiviert. Dafür gibt es unterschiedliche Quellen der Gewissensbildung.
Für Ralf Dahrendorf, deutsch-britischer Soziologe, Politiker und Publizist, ist das der sogenannte „sense of belonging“. Was ist das einigende Band? Die Bedeutung liegt demnach in der „Einigkeit über das Unabstimmbare“.
Steins Fazit: Mit der Demokratie ist eine bestimmte Haltung verbunden, die sowohl einen legitimen Raum für Andersartigkeit, aber auch Loyalität zur Rechtsordnung vorsieht. Aus diesem Grund muss das Grundgesetz verteidigt werden! Ein freiheitlicher Verfassungsstaat kann sich nicht von alleine am Leben erhalten.
Wie steht es um die Gleichberechtigung im Grundgesetz?
Prof. Dr. Ute Sacksofsky, Vizepräsidentin des Hessischen Staatsgerichtshofes und Professorin für Öffentliches Recht an der Johann Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt/Main konzentriert sich in ihrem Vortrag „Das Grundgesetz und die Gleichberechtigung“ auf die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Im Grundgesetz Art. 3, 2 steht: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“. Diese Formulierung, so Sacksofsky, sei „hart erkämpft“ gewesen. Der Streit um die Gleichberechtigung war mit der Schaffung dieser Norm allerdings nicht vorbei. Sie ging weiter: Am 1. Juli 1958 trat das „Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts“ in Kraft. Weitere Zwischenschritte, vor allem im BGB, folgten. Erst 1994 aber wurde Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes um folgenden Satz erweitert: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“
Sacksofsky unterscheidet in ihrem Vortrag zwei Konzeptionen der Gleichberechtigung: die formale und die materiale.
Nach der formalen Gleichberechtigung darf Geschlecht keine rechtliche Kategorie bzw. kein rechtliches Merkmal sein. Alle Geschlechter sollen die gleichen Ausgangsbedingungen haben. Dieses Konzept sieht Sacksofsky aber nicht als ausreichend an. Sie formuliert als Ziel: materiale Gleichberechtigung.
Dieses Konzept steht für einen Paradigmenwechsel, in dem Kontextualisierung eine wichtige Rolle zukommt. Denn: identische Behandlung ist nicht gleich Gleichbehandlung (Beispiel: Steuern zahlen abhängig vom Einkommen – identische Steuern unabhängig vom Einkommen wäre keine Gleichbehandlung).
Man muss sich dabei grundlegend fragen: Was verstehen wir unter Gleichheit? Wichtig ist es, dabei die Ausgangslage und Bedürfnisse der Personen einzubeziehen. Gleichheit meint das Recht, als Gleicher behandelt zu werden.
Doch wie lässt sich das in die Thematik der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau übersetzen?
Diskriminierungsbekämpfung kann nicht symmetrisch sein, sagt Sacksofsky. Man muss betrachten: Wer ist in der Minderheit? Wer bildet die Mehrheit? Es geht dabei in erster Linie um ein strukturelles Phänomen, um Mehrheitsverhältnisse in der gesellschaftlichen Wirklichkeit unter Berücksichtigung historischer Erfahrungen.
Um hier etwas zu erreichen, ist eine Vorstellung vonnöten. Wo wollen wir hin? Wie soll die gleichberechtige Gesellschaft aussehen? Die herkömmliche Geschlechterordnung ist bislang binär, folgt biologischen Vorgaben, geht von einem unveränderten Geschlecht aus und von der Annahme, dass sich das sexuelle Begehren auf eine Person des anderen Geschlechts ausrichtet. Heute ist allen klar, dass das so nicht mehr stimmt.
Sacksofsky fragt daher: Woher kommen diese Annahmen? Die Wurzeln liegen laut Sacksofsky in der Aufklärung. In dieser Epoche schlug die Stunde der Naturwissenschaften, ihre Bedeutung wurde größer als nie zuvor – und Geschlecht wurde so mit Biologie begründet. Aus der Biologie wurden wiederum soziale Funktionen abgeleitet, die unterschiedliche Geschlechtscharaktere prägten (vgl. Eigenschaftszuschreibungen von Männern und Frauen in Schillers „Glocke“).
Die bisherige Geschlechtsordnung ist trotz aller Fortschritte noch immer wirkmächtig. Sacksofsky: „Heute ist das Problem nicht mehr die böse Absicht, sondern die Verinnerlichung historischer Erfahrung, Wahrnehmung und Sozialisation“. Dagegen etwas zu tun ist nach Auffassung Sacksofskys die Aufgabe des Rechts!
Sie plädiert für die Rechtsfigur der mittelbaren Benachteiligung beim Ehegattensplitting. Diese Forderung ist zentral! Vor allem Frauen seien es, die durch das Ehegattensplitting klar benachteiligt würden.
Darüber hinaus ist Sacksofsky für Quotenmodelle. Hier sei aber dringend geraten, genau zu unterscheiden, ob Quoten zur Inklusion oder zur Exklusion genutzt werden.
Sacksofsky spricht sich gegen symmetrische Quoten aus (Mindestquoten für beide Geschlechter). Mindestquoten für Männer kann sie nicht nachvollziehen, weil diese Forderung völlig an der Lebensrealität vorbeigehe.
Bestandsaufnahme
Zu einer politischen Bestandsaufnahme waren die Politiker Dr. Günter Krings MdB, Dr. Manuela Rottmann MdB und Stephan Thomae MdB zur Tagung gekommen. Thema der Podiumsdebatte: „Das Grundgesetz und die Veränderungswünsche/ -notwendigkeiten heute“.
Das CDU-Parteimitglied Krings beobachtet eine Stimmungsänderung anlässlich des 70. Jubiläums der Verfassung. Es sei positiv, dass nun wieder stärker inhaltlich über die Verfassung diskutiert werde. Er lobt, dass es zum Jubiläum keine Feierstunde gegeben habe, sondern eine Debatte. Die inhaltliche Auseinandersetzung sei gleichwohl auch Gebot der Stunde – schließlich werde die Gesellschaft immer vielfältiger. Die Effekte der Globalisierung, der Klimaschutz und die Digitalisierung stellen auch für das Grundgesetz neue Herausforderungen dar
Zur Diskussion über die Verfassungsänderungen ist er der Auffassung, dass die Verfassung zu oft auf „ein Podest gestellt“ werde. In erster Linie sei die Verfassung aber ein Normtext. Der Urtext von 1949 sei gleichwohl einer „der schönsten Texte“. Die 63 Änderungen, die das Grundgesetz in den vergangenen 70 Jahren erfahren habe, spiegelten auch die politischen Gerangel ihrer Zeit wider.
Krings möchte „eine Lanze brechen für Verfassungsänderungen“ – sie stellten eine Möglichkeit dar, den Text an neue Gegebenheiten anzupassen. Er ist gleichzeitig aber auch der Meinung, dass man es „damit aber auch nicht übertreiben sollte“. Bei jeder Änderung sollte gewissenhaft geprüft werden: Muss diese Änderung wirklich sein? Zuweilen sei es so, dass das Grundgesetz überfrachtet werde, weil es Dinge dem demokratischen Gesetzgeber entziehe. Die Verfassung könne nicht alles leisten – Verfassungspatriotismus sei dennoch notwendig.
Manuela Rottmann (Bündnis 90/Die Grünen), ist der Auffassung, dass sich der Gesetzestext an veränderte gesellschaftliche Konsense anpassen muss, wie zum Beispiel bei der Einstellung zu Homosexualität. Viel sei hier schon geschehen, viele gute Initiativen spiegeln sich in den Änderungen wider. Was sei also noch zu tun?
Drei Punkte sind ihr hier besonders wichtig. Im Abschnitt zur Diskriminierung sei es dringend nötig, den Zusatz „wegen seiner sexuellen Identität“ aufzunehmen, um auch hier die Lebenswirklichkeit und den gesellschaftlichen Konsens hinsichtlich des Themas aufzunehmen.
Der zweite Punkt betrifft den Klimaschutz – und ist gleichwohl, das weiß auch Rottmann, im Grundgesetz nicht umsetzbar. Sie plädiert aus diesem Grund für eine Verankerung des Klimaschutzes, bei dem die internationalen Klimaschutzziele zum verbindlichen Maßstab erklärt werden – ähnlich der Gesetzesvorgabe für die Schuldenbremse. Rottmann kritisiert in dem Zusammenhang ein „demokratisches Loch“: Der Gesetzgeber vertritt zwar die aktuelle Generation, macht aber auch Politik für die zukünftige.
Als dritten Punkt bringt Rottmann den Föderalismus an. Das Bundesstaatsprinzip sollte sich in der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse widerspiegeln, Stichwort: Bildungsföderalismus, Sicherheitsföderalismus. Kann der Föderalismus der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gerecht werden bzw. sie befördern? Als neues Problem kommt in Deutschland die räumliche Spaltung hinzu, das Auseinanderfallen von Peripherie und Ballungsräumen und ihren Folgen für die Gesellschaft. Die Antwort darauf war bislang oft: Föderalismus. Was aber soll der Bundesstaat sein, was soll er leisten?
Rottmann spricht sich für das stärkere Einbinden der Zivilgesellschaft aus, sie plädiert für eine neue verfassungspolitische Debatte.
Der FDP-Politiker Stephan Thomae erinnert daran, dass das Grundgesetz 65 „Väter“ und nur vier „Mütter“ gehabt habe und dennoch eine „ungeheure Akzeptanz“ erfahren habe. Sein Erfolg ist, dass es Halt gibt und als „Glücksfall für die deutsche Geschichte“ gelten darf – auch im internationalen Vergleich. Thomae stellt aber auch die Frage danach, inwieweit das heute noch ausreicht. Er warnt davor, eine „Bannmeile“ um das Grundgesetz zu ziehen. Es gebe Befürchtungen über Änderungen des Grundgesetzes, es gebe aber auch Notwendigkeiten dafür.
Er stellt Fragen zu drei konkreten Komplexen: 1. Sollte das Grundgesetz widerstandsfähiger gemacht werden? Der Blick nach Ungarn und Polen und den Verfassungsänderungen, die in diesen Ländern vonstatten gegangen sind, geben Grund zur Beunruhigung. „70 Jahre friedvolle Geschichte bedeuten nicht, dass es so stabil weitergeht“, sagt Thomae. Hinzu kommt: Das Wahlrecht ist nur einfach gesetzlich geregelt.
2. Wie kann die parlamentarische Demokratie gestärkt werden? Thomae selbst bezeichnet sich als „Freund der zivilgesellschaftlichen Beteiligungsprozesse. Dennoch ist er hinsichtlich Volksabstimmungen vorsichtiger geworden. Der Brexit etwa habe gezeigt, wie Stimmungen durch Halbwahrheiten erzeugt werden können – mit fatalen Folgen. Er ist dafür, das Vertrauen in die parlamentarischen Verfahren zu stärken.
3. Frage: Sollte man eine Eigentumsdebatte führen und wie? Er sieht Eigentum als schützenswert an und stößt sich daran, dass die „FridaysForFuture“-Bewegung eine stark kapitalismuskritische Ausprägung bekommen hat („Kill capitalism not climate“). Er befürwortet Kapitalismus, spricht sich für mehr Wettbewerb aus und für eine kapitalistische Eigentumsordnung aus.
Allgemein fügt er hinzu, dass er die Debatte über den Kinderschutz im Grundgesetz für unangebracht hält: Kinder seien auch Menschen und überall wo Menschen geschützt werden, werden auch Kinder geschützt. Darüber hinaus sollte der Staat in punkto Eltern- und Erziehungsrecht keine zu hohe Einflussnahme haben. Thomae spricht sich für eine Staatszielbestimmung aus.
„Was ist den Deutschen ihr Grundgesetz wirklich wert?“
Die Journalisten Stephan Detjen, Albert Funk und Marlene Grunert waren zum Podiumsgespräch zur Tagung nach Tutzing gekommen, um sich dieser Frage zu widmen.
Albert Funk, Journalist und Korrespondent im Hauptstadtbüro des Berliner Tagesspiegels, glaubt, dass die Deutschen den Prozess der Verfassungsfindung eher hingenommen haben als aktiv unterstützt. Als Gründe für diese Haltung führt er an, dass das Bundesstaatsverhältnis nicht geklärt sei, auch der Verfassungskonsens sei es nach wie vor nicht. Darüber hinaus passe das aktuelle Wahlsystem nicht zum Parteiensystem. Die Frage: „Wie bekommen wir einen funktionierenden Bundestag hin?“ werde zu wenig gestellt. Insgesamt pflegten die Deutschen gegenüber der Verfassung ein Verhältnis der „wohlwollenden Gleichgültigkeit“ gepaart mit „punktuellem Aktionismus in Einzelfragen“. Schuld daran sein auch eine gewisse „Demokratiefaulheit“ innerhalb der Bevölkerung. Das etwas distanzierte Verhältnis zum Grundgesetz sei auch ein Resultat der Haltung, dass das „System ja funktioniert“.
Die Journalistin Marlene Grunert aus dem Politik-Ressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fragt, ob der Verfassungspatriotismus sein Versprechen einlöse. Sie stellt fest, dass Verfassungsfolklore, wie es sie in anderen Ländern gebe, in Deutschland nur sehr schwer zu finden sei. „Wir haben noch nicht einmal einen republikweiten Feiertag oder andere Institutionen, die diese Aufgabe übernehmen könnten.“ Grunert erinnert an Pläne wie die zu einem deutschen Verfassungsmuseum oder auch dem „Forum Recht“ in Karlsruhe.
Es sei oft beobachtet worden, dass sich die Deutschen schwer tun mit der politischen Tradition. Aber: Wer sind eigentlich die Deutschen? In Umfragen wurde klar: Über das Grundgesetz ist allgemein wenig Wissen bei „den Deutschen“ vorhanden. Dies ließe sich über den Aufbau und die Pflege von Traditionen verbessern. Sie ist der Meinung, Traditionen lassen sich auch erfinden. Darüber hinaus regt Marlene Grunert an, der Auseinandersetzung mit dem Grundgesetz schon in der Schule Raum zu geben. Wichtig sein, in allen Schulformen das Grundgesetz zu unterrichten.
Stephan Detjen, Journalist und Chefkorrespondent des Deutschlandradios im Hauptstadtstudio Berlin, beobachtet, dass das Grundgesetz anfangs kaum angenommen wurde, weil es zu wenig bekannt war. Was noch heute zu wenig bekannt ist: Das Grundrecht richtet sich an alle, die in Deutschland leben, nicht nur an diejenigen mit deutscher Staatsbürgerschaft.
Das Verhältnis der Deutschen zu ihrem Grundgesetz beschreibt Detjen als eine „Geschichte der Annäherung“, die sich an einem Ort vollzieht: dem Bundesverfassungsgericht. Die Beziehungsgeschichte ist auch eine Streitgeschichte – zunächst die einer institutionellen Streitgeschichte mit dem Bundesgerichtshof, dann aber auch inhaltlich. Der Satz „Dann gehe ich nach Karlsruhe“ ist mittlerweile zu einem geflügelten Satz geworden.
Detjen verweist auf die Lehren Peter Häberles: „Der Bayreuther Staatsrechtler steht in einer der großen Traditionslinien des deutschen Staatsrechts, die auf den Weimarer Verfassungsrechtler Rudolf Smend zurückgeht und in der neuartigen Grundrechte-Auslegung des Bundesverfassungsgerichts zum Durchbruch kam. Verfassung ist in diesem Verständnis nicht nur Staatsorganisation, sondern auch Ausdruck der kulturellen und sozialen Prägungen einer Gesellschaft.“
Der Journalist Detjen stellt gleichwohl fest, dass es im Augenblick wieder eine Phase des Streits um das Grundgesetz gebe. Dieser habe mit der Eurokrise begonnen und sei durch die Flüchtlings- und Integrationspolitik weiter verstärkt worden – hinzu kam das Aufkommen der AfD, die sich gleichwohl als Rechtstaatspartei sieht.
Detjen ist bei allen inhaltlichen Auseinandersetzungen der Auffassung, dass die Auseinandersetzung über die Verfassungsinterpretation in heterogenen Gruppen geschehen muss. Seiner Meinung nach sei das Thema Demokratie noch angesehen – nur die „Gefäße“, in denen sie transportiert und diskutiert werden, hätten sich verändert. Heute gebe es andere Medien und andere Formen, in denen debattiert werde und Austausch stattfinde. Plattformen wie etwa YouTube werden aus Sicht des Journalismus durchaus als Bedrohung wahrgenommen, dennoch böte das Internet für die Branche aber auch viele Chancen. Als Beispiel dafür führt Detjen Podcasts an, wie sie etwa der Deutschlandfunk verstärkt produzieren.
Dorothea Grass, Juli 2019